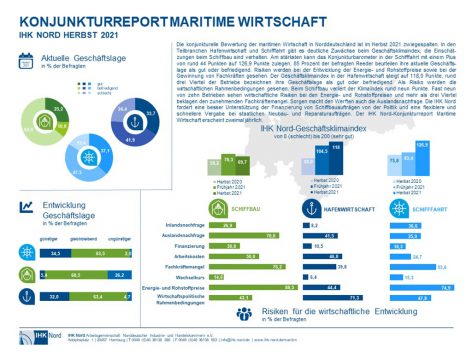Trend Report „Future of Work in Logistics“

Im aktuellen Trendreport „Future of Work in Logistics“ untersucht DHL, wie sich die Arbeitswelt – genauer die Stellenprofile, Verantwortlichkeiten, Systeme, Zeitpläne, Tools und Arbeitsbedingungen von Logistikmitarbeitern – im kommenden Jahrzehnt verändern wird. Angesichts des zunehmenden Fachkräftemangels und des Werbens um Talente müssen Unternehmen Strategien entwickeln, um Mitarbeiter im digitalen Zeitalter für sich zu gewinnen, an sich zu binden, zu fördern und langfristig zu motivieren.
Mehr als 7.000 Fachleute der Logistik- und Lieferkettenbranche haben sich für den Trend Report zu den Chancen und Herausforderungen geäußert, mit denen sie sich aktuell konfrontiert sehen.
Zum ersten Mal in der Geschichte wird die Zahl der Digital Natives die derjenigen übersteigen, die ihre berufliche Laufbahn noch vor dem Internet begonnen haben. Dieser anhaltende Zustrom junger Menschen in die Belegschaften beschleunigt einen Wertewandel am Arbeitsplatz. Millennials und die Generation Z setzen die Logistikbranche unter Druck, neue Erwartungen in Bezug auf Nachhaltigkeit, Vielfalt und Inklusion, das Wohlbefinden der Mitarbeiter und ein technologieorientiertes Umfeld zu erfüllen. In Kombination mit Verbesserungen in den Bereichen Digitalisierung, Automatisierung und künstliche Intelligenz hat dies bereits heute erhebliche Auswirkungen auf Arbeitsplätze, Arbeitsstätten und sogar auf ganze Branchen weltweit.
„Während 9 von 10 Befragten der Meinung sind, dass Technologie für ihre Karriere hilfreich war, gaben immerhin mehr als 50 % zu, dass sie künstliche Intelligenz und Automatisierung auch als potenzielle Bedrohung ansehen“, sagte Matthias Heutger, SVP und Global Head of Innovation bei DHL. „Dies stellt eine große Chance und Verantwortung für Unternehmen und Regierungen dar, schnell und gemeinsam zu handeln, um Bedenken zu zerstreuen. Es braucht transparente Strategien für die Zukunft und erfolgreiche Beispiele von Arbeitsplätzen an denen Mensch und Maschine bereits zusammenarbeiten müssen stärker herausgestellt werden, um den Mitarbeitern Vertrauen in dieses neue Form der Zusammenarbeit zu geben.“
Die Experten gehen nicht davon aus, dass in der Logistikbranche ein dramatischer Wechsel von der menschlichen Arbeit hin zu einer vollständigen Automatisierung stattfinden wird. Die Befragten sehen vielmehr einen graduellen Wandel über einen Zeitraum von 30 Jahren, in dem Beschäftigte vermehrt mit neuen Technologie zusammenarbeiten, anstatt mit diesen Technologien zu konkurrieren – entgegen der Befürchtungen einiger Arbeitnehmer. Darüber hinaus erwarten die Autoren des Trend Reports eine geografisch eher ungleichmäßige Verteilung des Einsatzes neuer Technologien. Einige Regionen und Teams entlang der Lieferketten werden dabei geringere oder zumindest langsamere Veränderungen erfahren als andere.
„Die Digitalisierung verändert die Art und Weise, wie wir leben und wie wir Geschäfte machen, bereits heute grundlegend. Die Pandemie hat die Umsetzung von Plänen, die Unternehmen bereits länger ins Auge gefasst hatten, nur beschleunigt. Wir gehen davon aus, dass bis 2030 rund 30-35 Prozent aller Tätigkeiten automatisiert werden könnten. Dennoch sind wir der festen Überzeugung, dass der Großteil unserer Wertschöpfung weiterhin von Menschen erbracht wird“, sagt Thomas Ogilvie, Personalvorstand von Deutsche Post DHL Group. „Es besteht kein Zweifel, dass sich bestimmte Arbeitsplätze zwar verändern werden, aber die Arbeit als solche wird bleiben. Das zeigt uns, dass lebenslanges Lernen mehr denn je der Schlüssel zum Erfolg im digitalen Zeitalter ist.“
Um diese neue Zukunft der Arbeit zu schaffen, ist es unerlässlich, nicht nur die Treiber dieser Trends zu verstehen, sondern auch auf die Bedürfnisse und Sorgen der Arbeitnehmer einzugehen. So gab ein Großteil der Befragten beispielsweise an, dass sie auch weiterhin in Teil- oder Vollzeit aus dem Büro arbeiten wollen. 6 von 10 Mitarbeitern im operativen Bereich wollen zumindest einmal pro Woche aus der Ferne arbeiten. Bei den Büromitarbeitern waren dies 5 von 10 Befragten. Die Unternehmen müssen sich also überlegen, wie sie flexible Arbeit durch neue Personalrichtlinien und Technologien wie Telearbeit leichter zugänglich machen können.
„Es ist wichtig, die Mitarbeiter zu fragen, wie sie sich fühlen und was sie sich wünschen. Wir verlassen uns stark auf dieses Feedback, um flexiblere Arbeitszeiten und -umgebungen einzuführen und neue, technologiegestützte Arbeitsmethoden zu entwickeln. Wir konzentrieren uns aber auch auf Maßnahmen wie „Moments that matter“, damit sich unsere Mitarbeiter nicht nur fachlich sondern auch emotional aufgehoben fühlen“, sagt Sabine Müller, CEO von DHL Consulting. „DHL Consulting ist stolz darauf, an diesem Trend Report mitgewirkt zu haben, und ist zuversichtlich, dass die Branche von den Erkenntnissen profitieren wird, die wir als Global Player in der Logistik vermitteln können.“
Die jüngste Vergangenheit hat gezeigt, dass es wichtig ist Art, Umfang und Geschwindigkeit dieser digitalen Veränderungen zu verstehen, um entsprechende Antworten für die Zusammenarbeit von Mensch und Maschine zu finden. Innerhalb nur weniger Wochen konnte ein Virus Veränderungen in der Arbeitswelt einleiten, für die Unternehmen normalerweise Jahre oder sogar Jahrzehnte gebraucht hätten. Während Geschäfte und Restaurants monatelang geschlossen blieben, erlebte der elektronische Handel weltweit ein beispielloses Wachstum. Immer mehr Menschen kauften online ein und Unternehmen, die traditionell im stationären Handel tätig waren, schlossen sich der Online-Wirtschaft an. Dieses Wachstum im e-Commerce hat auch zu einem massiven Anstieg der Nachfrage nach Logistikkräften geführt, die bei der Kommissionierung, dem Transport und der Auslieferung von Milliarden Bestellungen pro Jahr helfen. Um die wachsende Nachfrage nach Logistik zu befriedigen, den Fachkräftemangel zu lindern und die Lieferketten stabiler zu machen, wurde die digitale Transformation der Logistik in Zeiten von Covid-19 stark vorangetrieben.
Teil 1 des Trend Reports ist nun verfügbar – digital und in mobil optimiertem Format. Die fünfte Ausgabe des interaktiven DHL Logistics Trend Radars, ein Kompass für die 29 wichtigsten geschäftlichen, technologischen und gesellschaftlichen Trends, die die Logistikbranche in den nächsten zehn Jahren am meisten beeinflussen werden, ist zudem abrufbar unter www.dhl.com/trendradar.
Quelle und Foto: DHL