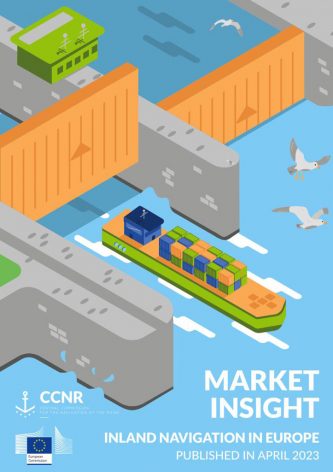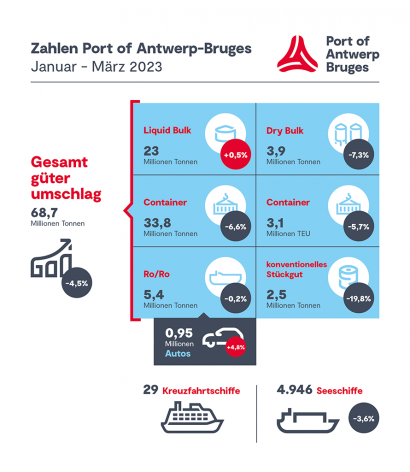Die duisport-Gruppe hat auch im vergangenen Jahr allen Krisen getrotzt und zieht eine positive Jahresbilanz 2022. Das vergangene Geschäftsjahr wurde vom Ukraine-Krieg und seinen Folgen wie der hohen Inflation und stark gestiegenen Energiepreisen ebenso geprägt wie von gestörten Lieferketten, dem Niedrigwasser im Sommer und den Auswirkungen der Corona-Pandemie. Obwohl die Gesamtleistung und der Güterumschlag leicht rückläufig waren, konnte das operative Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr sogar gesteigert werden.
„Die wirtschaftlichen Auswirkungen des Ukraine-Kriegs waren für die duisport-Gruppe glücklicherweise nicht so stark, wie wir zunächst befürchten mussten. Die Folgen des Niedrigwassers im Sommer und den Rückgang in der deutschen Chemie-Produktion haben wir dafür umso mehr gespürt. Trotz der massiven Beeinträchtigungen und Herausforderungen hat sich unser Kerngeschäft aber als äußerst stabil und resilient erwiesen“, fasst CEO Markus Bangen zusammen.
Die Gesamtleistung der duisport-Gruppe lag 2022 trotz des angespannten Marktumfeldes bei 332,7 Mio. Euro. Bereinigt um den Effekt eines Einmalerlöses im Vorjahr konnte das operative Ergebnis damit sogar gesteigert werden. 2021 war die Gesamtleistung in Höhe von 346,8 Mio. Euro maßgeblich durch den Verkauf einer Logistikhalle für rund 18 Mio. Euro geprägt worden.
„Dass wir es geschafft haben, im operativen Geschäft trotz aller Krisen zu wachsen, ist herausragend“, sagt Markus Bangen. „Mein großer Dank gilt allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihren unermüdlichen Einsatz in diesem schwierigen Jahr.“
Das EBITDA betrug 42 Mio. Euro, das EBIT 22,2 Mio. Euro. Beide Werte liegen – abzüglich des Sondereffekts – damit wieder auf dem Niveau der Vorjahre. Die Bilanzsumme der duisport-Gruppe stieg im Vergleich zum Vorjahr aufgrund von Investitionen und der Ausweitung des Geschäftsbetriebes von 438,7 Mio. Euro auf 454,7 Mio. Euro (+3,6 Prozent).
Im Geschäftssegment Infra- und Suprastruktur erzielte die duisport-Gruppe eine Gesamtleistung in Höhe von 60,2 Mio. Euro und lag damit um 8,2 Prozent über dem Niveau des Vorjahres (2021: 55,6 Mio. Euro). Die begonnenen Neuinvestitionen sowohl in Infrastruktur als auch in weitere Terminal- und Warehouse-Kapazitäten werden hier auch zukünftig für weiteres Wachstum sorgen, insbesondere auch durch Umstrukturierungen und neue Nutzungen in den bestehenden Hafenbereichen.
Im Geschäftssegment Logistische Dienstleistungen sank die Gesamtleistung im Jahr 2022 um 22,9 Prozent auf 90,0 Mio. Euro (2021: 116,7 Mio. Euro). Ausschlaggebend hierfür ist hauptsächlich der bewusste Rückgang des Projektgeschäfts der duisport consult GmbH.
Das Geschäftssegment Verpackungslogistik erreichte 2022 eine Gesamtleistung von 105,8 Mio. Euro, nachdem im Vorjahr Erlöse in Höhe von 94,6 Mio. Euro erzielt werden konnten (+11,8 Prozent). Damit konnte das Vor-Corona-Niveau von 102,0 Mio. Euro aus dem Jahr 2019 übertroffen werden.
Das Geschäftssegment Kontraktlogistik erzielte eine Gesamtleistung in Höhe von 32,6 Mio. Euro. Dies entspricht einem Anstieg von 10,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr (2021: 29,5 Mio. Euro).
Der Containerumschlag ist im Geschäftsjahr 2022 leicht auf rund 4,0 Mio. TEU (2021: 4,3 Mio. TEU; -7 Prozent) gesunken. Insgesamt hat die duisport-Gruppe im vergangenen Jahr 54,9 Mio. Tonnen (2021: 58,2 Mio. Tonnen) Güterper Schiff, Bahn und Lkw umgeschlagen. Der Gesamtumschlag in allen Duisburger Häfen (einschließlich privater Werkshäfen) ist 2022 ebenfalls leicht gesunken auf insgesamt 104,9 Mio. Tonnen (2021: 111,1 Mio. Tonnen; -5,7 Prozent).
Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat die duisport-Gruppe trotz der kritischen Material- und Lieferantenverfügbarkeit sowie des starken Anstiegs der Einkaufspreise rund 55,0 Mio. Euro an finanziellen Mitteln für Sach- und Finanzinvestitionen sowie Instandhaltungsmaßnahmen aufgewendet, um die Infra- und Suprastruktur des Duisburger Hafens und damit den Standort Duisburg weiter zu stärken.
Schwerpunkt 2023: Investitionen in die Drehscheibe Duisburg
Massive Investitionen in den Standort Duisburger Hafen, die Weiterentwicklung zu einem zentralen Hub für nachhaltige Energieprodukte sowie der Ausbau des internationalen duisport-Netzwerks stehen im aktuellen Geschäftsjahr ganz oben auf der Agenda.
„Wir werden allein in diesem Jahr rund 100 Millionen Euro in die Hafeninfrastruktur, also Straßen, Brücken, Gleise und Hafenanlagen investieren, um die Leistungsfähigkeit der größten Logistikdrehscheibe Zentraleuropas zu erhalten und zu erweitern“, erläutert Lars Nennhaus, der seit dem 1. Januar dieses Jahres duisport-Vorstand für die Bereiche Technik und Betrieb ist. „Die Modernisierung und der Ausbau der Infrastruktur vor Ort hat für uns oberste Priorität“, so Nennhaus.
Im Bereich der Eisenbahn-Infrastruktur steht die Wiederherstellung der Anschlussbahn Walsum zur Anbindung von logport VI sowie die Modernisierung und Erweiterung der vorhandenen Gleisanlagen im Fokus. So erhält z.B. logport I ein weiteres mit Fahrdraht überspanntes Ausfahrgleis für 740 Meter lange Züge und eine Erweiterung der Einfahrtgleise.
Im Bereich der Hafeninfrastruktur stehen neben dem Aus- und Umbau interner Terminalstraßen der Ersatz und Neubau von Umschlagufern sowie der Start des zweiten Bauabschnitts der Süd-West-Querspange Hamborn/Walsum zur Anbindung von logport VI an das überregionale Straßennetz im Fokus.
Eines der wichtigsten Zukunftsprojekte im Duisburger Hafen nimmt dabei parallel Gestalt an: Der Bau des Duisburg Gateway Terminal (DGT) auf der ehemaligen Kohleninsel liegt voll im Zeitplan. Voraussichtlich im Sommer dieses Jahres wird die Brücke zum benachbarten Hafengebiet in Duisburg-Ruhrort fertig montiert. Anfang des zweiten Quartals 2024 soll das größte Containerterminal im europäischen Hinterland, das komplett klimaneutral betrieben wird, in Betrieb gehen.
Ebenfalls im Zeitplan befindet sich der Bau des Intermodal-Terminals „Railport“ in Kartepe bei Istanbul, das duisport gemeinsam mit der türkischen Arkas Holding baut. Mit der Fertigstellung des ersten Bauabschnitts ist Mitte 2024 zu rechnen. Damit stärkt die duisport-Gruppe – vergleichbar mit der Beteiligung im Hafen von Triest – ihre Präsenz im Mittelmeerraum und wird durch den Aufbau und die Vermarktung zuverlässiger Logistikketten von künftigen Warenströmen in Zentraleuropa profitieren. „Neben der bestehenden Anbindung an die Westhäfen werden schnelle und sichere Verbindungen an die Häfen im Mittelmeer eine immer wichtigere Rolle spielen“, sagt Dr. Carsten Hinne, duisport-Vorstand für das internationale Netzwerk.
In 2022 hielt die duisport-Gruppe Beteiligungen an verschiedenen operativen Gesellschaften im Ausland, unter anderem in den Niederlanden, Belgien, Frankreich, Italien, Polen, der Türkei, Indien, China und Singapur. „Wir werden den Logistik-Hub Duisburg ständig weiterentwickeln und unsere Aktivitäten nicht nur in Asien, sondern auch in Europa weiter diversifizieren“, erklärt CEO Markus Bangen.
Die strategischen Beteiligungen und Kooperationen mit Partnern im In- und Ausland zahlen ebenso wie die Investitionen in die Infrastruktur auf die langfristigen Ziele von duisport ein. Markus Bangen: „Eine zukunftssichere Infrastruktur, stabile Logistikketten und die Verknüpfung logistischer Dienstleistungen schaffen innerhalb der Energie- und Logistikdrehscheibe Duisburger Hafen die idealen Voraussetzungen für die unerlässliche Wettbewerbsvielfalt. Damit leisten wir einen wichtigen Beitrag, um die Wirtschaftsstandorte Duisburg, Nordrhein-Westfalen und Deutschland nachhaltig zu stärken.“
Quelle: duisport, Foto: duisport/ krischerfotografie, der Vorstand der duisport-Gruppe bei der Bilanzpressekonferenz von links: Dr. Carsten Hinne, Markus Bangen (CEO), Lars Nennhaus.