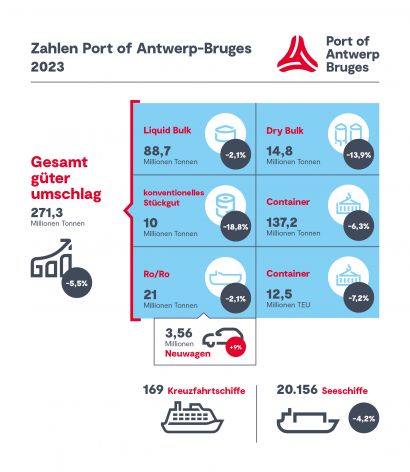„Rail Connected“, das Programm zur effizienteren Gestaltung des Informationsaustauschs zwischen Spediteuren, Schienenverkehrsbetreibern und Terminals, ist auf einem guten Weg. Im kommenden Frühjahr können die Nutzer selbst verfolgen, wie die Züge in Bezug auf Waggons, Lokomotiven und Container zusammengestellt werden. Die Rotterdamer Schienengüterverkehrsbranche ist inzwischen weitgehend angeschlossen und die Teilnehmer haben beschlossen, das Programm um zwei Jahre zu verlängern.
Das Wachstumsprogramm „Rail Connected“ ist das Ergebnis des Maßnahmenpakets Schienengüterverkehr zur Förderung des Gütertransports auf der Schiene. Das Programm wird vom niederländischen Ministerium für Infrastruktur und Wasserwirtschaft und der Port of Rotterdam Authority finanziert. Die Port of Rotterdam Authority koordiniert das Programm, das gemeinsam mit den Marktteilnehmern gestaltet wird.
Ziel ist es, den Informationsaustausch zwischen Spediteuren, Schienenverkehrsbetreibern und Terminals durch Digitalisierung effizienter zu gestalten und so die Anzahl manueller Vorgänge zu reduzieren. Der erste Schritt ist getan: die Voranmeldung der Züge. Einmal wöchentlich melden sämtliche Teilnehmer digital, welche Züge in der Folgewoche verkehren werden. Schritt 2 – die „Zugbildung“ – geht im Januar in die letzte Testphase. Dann wird die Zusammenstellung der Güterzüge in Bezug auf Lokomotive, Waggons und Container digital dargestellt.
Vor kurzem konnte Rail Connected die Cabooter Group als 25. Partei begrüßen. Gemeinsam mit APM Terminals Maasvlakte II, Combi Terminal Twente-Rotterdam, Contargo, Danser Containerline, DB Cargo Nederland, DistriRail, DP World Intermodal, ERS Railways, Hutchison Ports Europe Intermodal, Haeger & Schmidt Logistics, Hutchison Ports ECT Rotterdam, KombiRail Europe, Lineas, LTE Logistics & Transport, Neska Container Line, Optimodal, PortShuttle, Rail Force One, Raillogix, Rail Service Center Rotterdam, Rotterdam Rail Feeding, RTB Cargo, Rotterdam World Gateway und Trimodal Europe ist die Rotterdamer Schienengüterverkehrsbranche damit weitgehend abgedeckt.
Rémon Kerkhof, stellvertretender Geschäftsführer von Optimodal, einem Logistikdienstleister mit Schwerpunkt auf den europäischen Containertransport auf Wasser, Schiene und Straße, bewertet diese Schritte als positiv. „Für uns als Betreiber liefert das keinen großen Mehrwert, aber für den Eisenbahnsektor insgesamt ist es von großer Bedeutung. Es ist ein Anfang. Das Momentum ist da, ausgehend von der gesamten Branche. Es wäre schade, wenn wir jetzt aufhören würden, vor allem auch, wenn man die Wachstumschancen betrachtet“.
Arno van Rijn stimmt dem zu. Der kaufmännische Geschäftsführer des Terminalbetreibers Hutchison Ports ECT Rotterdam war bereits an den Vorgängern von Rail Connected beteiligt, HaROLD und OnTrack. „Bei ECT ist uns seit längerem bewusst, dass Digitalisierung unabdingbar ist, um auch in Zukunft ein wettbewerbsfähiges Bahnangebot zu schaffen. Die vorgenannten Projekte waren sehr ehrgeizig. Die Schritte, die wir jetzt im Rahmen von Rail Connected unternehmen, sind überschaubarer. Sie liefern Ergebnisse und sind für alle Beteiligten umsetzbar. Damit schaffen wir die richtige Basis.“
„Wir erhöhen Effizienz und Qualität“, so Van Rijn weiter. „Wir tippen PDF-Dateien nicht mehr in unser eigenes System ein, was zwangsläufig zu Fehlern führte. Das ist natürlich noch nicht alles. Vieles ist noch erreichbar, so z. B. Vorhersagen zur voraussichtlichen Ankunftszeit von Zügen.“
Wichtig bei jedem Digitalisierungsprojekt ist die Verwendung bestehender Schnittstellenstandards. Was ist mit den verwendeten Termini und Begriffen gemeint? „Man muss eine gemeinsame Sprache sprechen. Das ist ausschlaggebend“, erläutert Gerwin Roke, Anwendungsmanager bei DB Cargo Nederland. „Durch die European Union Association for Railways (ERA) wurden bereits Standards für Frachtbrief- und Zugdaten geschaffen. Bei der Art und Weise, wie Terminals und Spediteure Standorte in ihren Systemen kodieren, bestehen jedoch noch Unterschiede. Diese werden wir jedoch allmählich auflösen. Die Stimmung bei Rail Connected ist gut. Jeder, ob groß oder klein, leistet seinen Beitrag. Es winkt die Aussicht auf mehr Effizienz, Transparenz und Zuverlässigkeit.“
„Wir haben das Gewicht, um gemeinsam grundlegende Schritte zu unternehmen“, äußert Suzanne Smit, Programmmanagerin im Auftrag der Port of Rotterdam Authority. „Die Voranmeldung läuft. Die Zugbildung steht in den Startlöchern. Im Jahr 2024 werden wir auch die Einführung der „estimated time of arrival“ (ETA) in Angriff nehmen. Wie das möglich ist, haben wir bereits herausgefunden, die Umsetzung müssen wir jedoch noch optimieren. Traktionsanbieter müssen die Zugnummer in MCA Rail hinzufügen, damit sie über das Zuginformationssystem von RailNetEurope mit der „Strecke“ verknüpft werden kann. Mit Hilfe von Sensoren im Gleis kann ProRail die ETA auf den Strecken verfolgen und aktualisieren. Dabei handelt es sich um den so genannten „überwachten Bereich“ von ProRail. Im „nicht überwachten Bereich“ fehlen diese Informationen noch. ProRail arbeitet jedoch an Kameras und Sensoren, so dass auch diese Abschnitte Informationen liefern werden. Dazu laufen Gespräche.“
Laut Smit werden bei der Digitalisierung der manuellen Vorgänge gute Fortschritte erzielt. „Das heißt allerdings nicht, dass wir unser Ziel schon erreicht haben. 2024 möchten wir ein integriertes Konzept erstellen, wie wir mit den digitalisierten Prozessen und den daraus resultierenden Daten Verladung, Strecken und Terminalbelegung optimieren können. Dies ist ganz im Sinne von Nextlogic, der integralen Planung für die Abfertigung der Containerbinnenschifffahrt im Rotterdamer Hafen.“
„Das wäre natürlich ein großer Schritt“, kommentiert Arno van Rijn von ECT. „Zur Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit des Schienengüterverkehrs genießt Zuverlässigkeit bei unseren Kunden höchste Priorität. Alles, was dazu beiträgt, die Züge rechtzeitig zu platzieren und zu entfernen, unterstützen wir mit ganzer Kraft. Heute ist es so, dass sich die Ineffizienz der Kette bei einer Partei manifestiert und für Flexibilität und Effizienz bei einer anderen Partei sorgt. Davon müssen wir weg. Das muss straffer und zuverlässiger werden. Ein integralerer Ansatz kann dabei sicherlich helfen.“
Rémon Kerkhof von Optimal hält dies ebenfalls für eine gute Lösung. „Jetzt müssen wir alles eins zu eins mit jedem Terminal und jeder anderen Partei separat koordinieren. Dies führt häufig zu Kompromissen, die nicht zwangsläufig die besten Lösungen sind. Bald wird das System das optimieren. An sich dürfte dies bei der Schiene leichter zu bewerkstelligen sein als bei der Binnenschifffahrt. Bei uns gibt es weniger Einflussparameter. Der Schienenverkehr ist per definitionem weniger flexibel. Damit will ich nichts bagatellisieren. Die Initialisierung wird allen Beteiligten einiges abverlangen, aber das war bei Nextlogic in der Binnenschifffahrt nicht anders. Das funktioniert dort jetzt immer besser. Und das wird uns auch auf der Schiene gelingen!“
Quelle und Foto: Port of Rotterdam