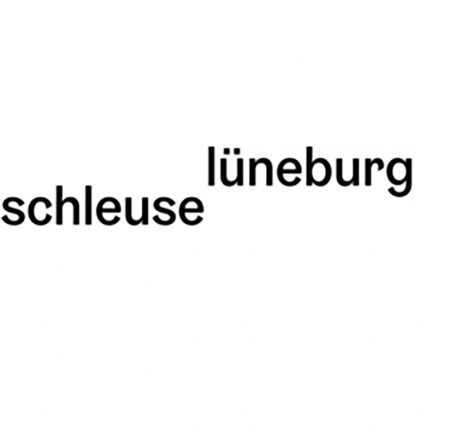In seiner Entwicklung zum digital gesicherten Hafen unternimmt Antwerpen den nächsten Schritt: Am 1. Januar 2021 startet mit „Certified-Pick-up“ eine sichere und integrierte digitale Lösung für die Containerfreigabe. Sie wird das bisherige System per PIN-Codes ersetzen. Die neue Plattform garantiert einen sicheren, transparenten und optimierten Freigabeprozess für ankommende Container, die den Hafen per Bahn, Binnenschiff, Lkw oder Seeschiff verlassen.
Um einen Container an einem Terminal im Hafen abzuholen, ist derzeit ein eindeutiger PIN-Code erforderlich. Dabei ist die Zeit, die zwischen der Übermittlung des PIN-Codes an die Reederei und der Eingabe dieses Codes durch den Fahrer am Terminal liegt, nicht unerheblich. Hinzu kommt, dass der PIN-Code von verschiedenen Akteuren eingesehen wird, was das Risiko eines Missbrauchs erhöht.
Um diesen Prozess sicherer und effizienter zu gestalten, geht am 1. Januar 2021 mit „Certified-Pick-up“ (CPu) ein neues Verfahren für die Freigabe von Containern in Betrieb. CPu ist eine neutrale zentrale Datenplattform, die alle am Container-Importprozess beteiligten Akteure miteinander verbindet.
Die CPu-Plattform empfängt und verarbeitet Containerinformationen, um einen codierten digitalen Schlüssel zu generieren, mit dem der jeweilige Transporteur den Container abholen kann. Dieser digitale Schlüssel wird erst dann erstellt, wenn der letztendliche Transporteur bekannt ist. Die Zeit zwischen der Erstellung des digitalen Schlüssels und der Abholung des Containers ist daher minimal.
Zudem lässt sich nachvollziehen, welche Akteure an der Abholung eines Containers beteiligt waren. Dies ermöglicht es den zuständigen Behörden wie Zoll und Polizei, im Rahmen ihrer rechtlichen Befugnisse auf die in „Certified-Pick-up“ ausgetauschten und generierten Daten zuzugreifen.
Langfristig soll es mit CPu möglich sein, den digitalen Schlüssel vollständig zu ersetzen, zum Beispiel durch ein identitätsbasiertes Sicherheitsverfahren mit Fingerabdrücken oder Augenscans.
CPu bietet allen Logistikpartnern in der Hafenkette auch operative Vorteile. Es vereinfacht die administrativen Prozesse, ermöglicht den Mitarbeitern ein sichereres Arbeiten und reduziert die Umschlagszeit von Importcontainern im Hafen. Auch Zoll und Polizei werden dank CPu effizienter und effektiver arbeiten können.
Hafenschöffin Annick De Ridder: „Mit dieser Initiative kommen wir als Hafen unserer sozialen Verantwortung nach. Ich schätze es sehr, dass die Hafengemeinschaft zur weiteren Sicherung der Logistikkette beiträgt. Mit dem digitalen Codesystem erschweren wir der Drogenmafia den Zugang zu den Containern an den Terminals erheblich. Ich möchte allen beteiligten Partnern dafür danken, dass sie dies möglich gemacht haben“.
Die Hafenbehörde und die Hafengemeinschaft führen einen offenen und konstruktiven Dialog mit allen beteiligten Logistikakteuren, darunter Reedereien, Schiffsagenten, Terminals, Verlader, Spediteure, Logistiker, Straßentransportunternehmen, Binnenschifffahrts- und Eisenbahnbetreiber. Gemeinsam beraten sie darüber, wie CPu weiter gestaltet und schrittweise umgesetzt werden kann.
Bernard Moyson, Vorsitzender von Alfaport-Voka: „Wir begrüßen es, dass dieses Projekt auf die schnellere, sicherere und effizientere Freigabe von Containern gerichtet ist. Ein kooperativer Ansatz ist der einzige Weg, um die Sicherheitsherausforderungen zu meistern. Dass wir einen konstruktiven Kompromiss für diese Initiative gefunden haben, beweist einmal mehr die Stärke und Widerstandsfähigkeit der Antwerpener Hafengemeinschaft. ”
Jacques Vandermeiren, CEO Hafen Antwerpen: „Dies ist die Geschichte einer gemeinschaftlichen Entwicklung mit dem Ziel, den Hafen Antwerpen als digitalen Hochleistungshafen noch besser zu positionieren. Wir haben eine hafenweite Beratungsstruktur eingerichtet, die das Projekt überwacht und gegebenenfalls anpasst.“
Quelle und Foto: Hafen Antwerpen