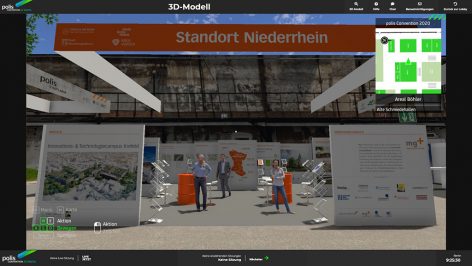BDB bei Expertenanhörung

Das westdeutsche Kanalsystem ist mit rund 40 Mio. per Binnenschiff beförderter Gütertonnen jährlich nach dem Rhein das Fahrtgebiet mit der zweithöchsten Tonnage im deutschen Wasserstraßennetz. Es spielt eine wichtige Rolle bei der Güterbeförderung im Hinterlandverkehr der großen Westseehäfen und der Versorgung der rohstoffintensiven Industrie im Westen der Republik. Im östlichen Ruhrgebiet ist der Hafen Dortmund mit seiner exzellenten Anbindung an das Rheingebiet, den Mittellandkanal und die Nordsee ein maßgeblicher Hafenstandort mit rund 3 Mio. t wasserseitigem Umschlag pro Jahr.
In den vergangenen Jahren war die Erreichbarkeit des Dortmunder Hafens, an dem direkt und indirekt rund 5.000 Arbeitsplätze hängen, jedoch stark beeinträchtigt. Grund dafür ist die äußerst störanfällige Schleuse Henrichenburg, die nur über eine Kammer verfügt und darüber hinaus die einzige wasserseitige Zufahrt zum Hafengelände ist. Der Bundesverband der Deutschen Binnenschifffahrt e.V. (BDB) hat daher am 2. September 2020, vertreten durch seinen Vizepräsidenten Roberto Spranzi (DTG, Duisburg), im Rahmen einer Anhörung vor dem Verkehrsausschuss im Landtag NRW qualifizierte Argumente für den Neubau einer zweiten Schleuse hervorgebracht und den dringenden Handlungsbedarf aufgezeigt.
Allein im Jahr 2019 war die Schleuse anderthalb Monate komplett für die Schifffahrt gesperrt, weitere anderthalb Monate wurde ein deutlich reduzierter Notbetrieb eingerichtet. Die nächste Vollsperrung aufgrund von Instandsetzungsarbeiten ist bereits für 2021 vom zuständigen WSA angekündigt. Derart lange Sperrzeiträume haben nicht nur massive negative wirtschaftliche Folgen für die Schifffahrtsunternehmen und den Hafen, sondern beeinträchtigen auch die Umwelt: Im Jahr 2018, in dem die Schleuse ebenfalls für einen längeren Zeitraum voll gesperrt war, gab die Dortmunder Hafen AG eine Verkehrsverlagerung in der Größenordnung von rund 25.000 Lkw-Fahrten bekannt.
„Damit wird das erklärte Ziel der Bundesregierung, künftig mehr Güter auf die umweltfreundliche Binnenschifffahrt verlagern zu wollen, völlig konterkariert. Gerade im dicht besiedelten Ruhrgebiet mit seinen chronisch verstopften Straßen ist die Binnenschifffahrt als Verkehrsträger unverzichtbar, um große Gütermengen zu transportieren. Ein Engpass im Wasserstraßennetz, wie ihn die Schleuse Henrichenburg seit Jahren darstellt, muss daher schnellstmöglich beseitigt werden, um eine ungewollte Verlagerung von Verkehren auf die Straße zu vermeiden. Hier besteht dringender Handlungsbedarf“, so BDB-Vizepräsident Roberto Spranzi.
Der Bau einer zweiten Schleusenkammer in Henrichenburg würde nicht nur die Problematik der Störanfälligkeit der vorhandenen Kammer beseitigen, sondern auch die Zukunftspotenziale des Dortmunder Hafens erschließen. Auch wenn die transportierten Kohlemengen durch den beschlossenen Ausstieg aus der Kohle als Energieträger im Bereich der Binnenschifffahrt voraussichtlich künftig rückläufig sind, werden andere Güter langfristig vermehrt den Weg auf die Wasserstraßen finden. So ist Binnenschifffahrt z.B. der ideale Partner, um die im Rahmen der immer weiter zunehmenden Bautätigkeiten anfallenden Abraummengen (Bauschutt, Abfallprodukte) zu transportieren. Das westdeutsche Kanalgebiet kann dabei eine zentrale Rolle spielen, da die abgetragenen Materialien in der Regel in Verbrennungsanlagen in die Niederlande verbracht werden. Da diese Stoffe vielfach sicherheitssensibel sind, eignet sich das Binnenschiff mit seinen hohen Sicherheitsstandards deutlich besser für den Abtransport als der Lkw, der die Gefahrstoffe über verkehrsreiche Straßen an den Zielort bringen müsste.
Es ist außerdem erklärtes Ziel im „Masterplan Binnenschifffahrt“ des BMVI, künftig mehr Schwergüter und Projektladungen auf die Wasserwege zu verlagern, die sich besonders gut für den Transport solcher besonders schweren und sperrigen Ladungen eignen. Im Gegensatz zur Straße müssen keine aufwendigen Vorbereitungen für den Transport getroffen werden (z.B. Abbau von Ampeln, Schildern etc., Einholen von Sondergenehmigungen) und ein Binnenschiff besitzt darüber hinaus den nötigen Ladungsraum, um große und schwere Güter zu befördern. Es besteht daher die Chance, dass sich der Hafen Dortmund mit seiner zentralen Lage im östlichen Ruhrgebiet und der hervorragenden Anbindung an Rhein, Nordsee und die ostdeutschen Wasserstraßen als wichtige Plattform für diese Transporte etablieren könnte.
„Der Bau einer neuen Schleuse Henrichenburg kann außerdem dem in den letzten drei Jahrzehnten stetig wachsenden Containergeschäft per Binnenschiff zusätzlichen Auftrieb geben. Im Kanalgebiet gibt es zwar derzeit noch limitierende Brückendurchfahrtshöhen. Diese sollen allerdings laut Bundesverkehrswegeplan 2030 angehoben werden, sobald Ersatzneubauten anstehen, so dass auch in diesem Fahrtgebiet langfristig wirtschaftlicher Containertransport auf dem Wasser möglich sein wird. Die Anpassung der Wasserstraßeninfrastruktur an die künftigen Entwicklungen des Gütertransports auf den Flüssen und Kanälen ist daher volkswirtschaftlich weitsichtig und höchst sinnvoll“, erklärt Roberto Spranzi.
In dem Antrag „Der Dortmunder Hafen braucht eine nachhaltige Zukunftsperspektive“ (Drucksache 17/8782) fordert die SPD-Fraktion die Landesregierung u.a. dazu auf, sich beim Bund für den Bau einer zweiten Schleuse Henrichenburg einzusetzen. Der BDB unterstützt diese Forderung ausdrücklich und hofft auf den Einsatz von NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst (CDU) in der Berliner Politik. Auf einer gemeinsamen Veranstaltung von BDB und dem Verband Spedition und Logistik NRW e.V. (VSL NRW) mit dem Titel „Binnenschifffahrt im Aufwind“ im vergangenen Jahr in Neuss hatte Minister Wüst sein Bekenntnis, sich in der Bundespolitik für die Stärkung des Systems Wasserstraße in NRW einzusetzen, bekräftigt.
Quelle: BDB, Foto: die Schleusenanlage Waltrop-Henrichenburg mit der aktuell genutzten Schleuse (r. im Bild) und dem seit 2005 außer Betrieb genommenen Schiffshebewerk.