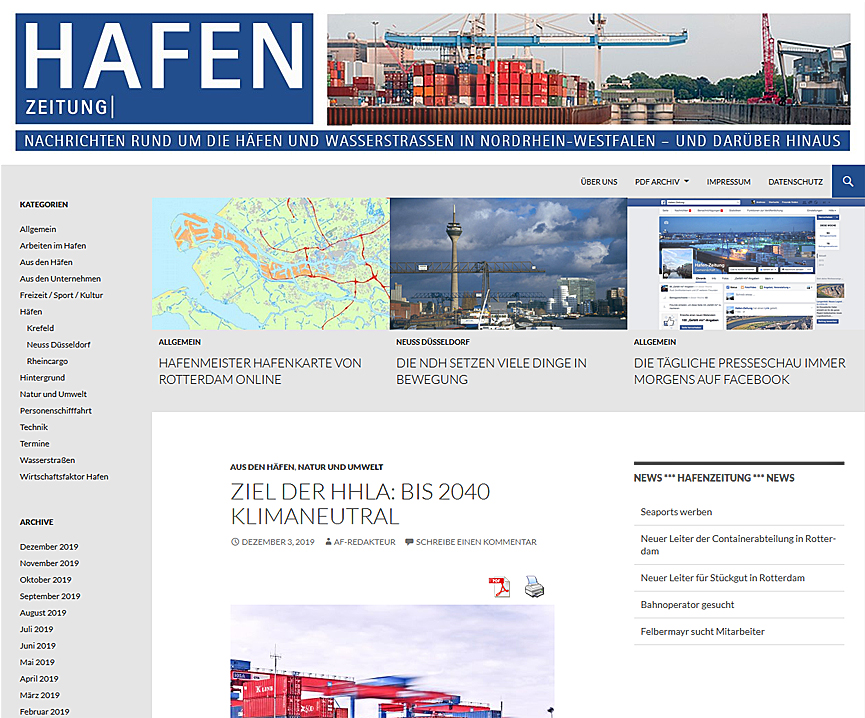Autonom fahrende, emissionsfreie Binnenschiffe in NRW

Einen Förderbescheid in Höhe von knapp 1,5 Millionen Euro hat der Staatssekretär im NRW-Verkehrsministerium, Dr. Hendrik Schulte, dem Entwicklungszentrum für Schiffstechnik und Transportsysteme (DST) in Duisburg bei einer Veranstaltung der Johannes-Rau-Forschungsgemeinschaft zum Thema „Green & Smart Shipping in NRW – Wann kommt das autonom fahrende, emissionsfreie Binnenschiff?“ überreicht.
Hierbei informierten Vertreter der Kooperationspartner DST, der Universität Duisburg-Essen, der RWTH Aachen und der Niederrheinischen Industrie- und Handelskammer über den aktuellen Stand der Forschung sowie laufende und anvisierte Projekte.
In Kooperation zwischen dem DST, der Universität Duisburg-Essen und der RWTH Aachen wird unter dem Projektnamen „VELABI“ ein Versuchs- und Leitungszentrum für autonome Binnenschiffe eingerichtet. Insgesamt werden acht Wissenschaftler mit der Erforschung und Testung neuer Technologien und Verfahren über 10 Jahre beschäftigt sein. Diese Forschungsinfrastruktur ist die Grundlage für weitere, praxisnahe Projekte mit der Industrie und Partnern aus unterschiedlichen wissenschaftlichen Disziplinen, wie Ingenieure, Informatiker, Stadtplaner oder Umweltforscher.

V.l.n.r.: Dirk Abel, IRT (RWTH Aachen); Dieter Schramm, Dekan (UDE); Hendrik Schulte, NRW-Verkehrsministerium, Bettar O. el Moctar, DST; Dieter Bathen, JRF; Ocke Hamann, Niederrheinische IHK
Der Förderbescheid wurde bei einer Veranstaltung der Johannes-Rau-Forschungsgemeinschaft überreicht, die am 14. November 2019 im DST zum Thema „Green & Smart Shipping in NRW – Wann kommt das autonom fahrende, emissionsfreie Binnenschiff?“ stattgefunden hat. Hierbei informierten Vertreter der Kooperationspartner DST, der Universität Duisburg-Essen, der RWTH Aachen und der Niederrheinischen Industrie- und Handelskammer über den aktuellen Stand der Forschung sowie laufende und anvisierte Projekte. In einer Podiumsdiskussion diskutierten Sie mit dem Publikum und dem Staatssekretär über die Zukunft der Binnenschifffahrt in NRW.
„Gerade am Logistikstandort Nordrhein-Westfalen, dem wichtigsten Binnenschifffahrtsland in Deutschland, müssen wir die freien Kapazitäten auf den Wasserwegen nutzen. Dafür werden hier innovative Technologien entwickelt und auch die Chancen der Digitalisierung und Automatisierung genutzt“, sagte Hendrik Schulte.
Ocke Hamann, Geschäftsführer der Niederrheinischen IHK, die 2018 mit einer Machbarkeitsstudie den Impuls für das Leistungszentrum gegeben hatte, unterstrich: „In unserer Region sind alle erforderlichen Voraussetzungen gegeben, um autonome Binnenschiffe unter realen Bedingungen zu testen und ein Testfeld systematisch auf größere Hafenareale und die Flussfahrt zu erweitern.“
Sind autonom fahrende Binnenschiffe mit Elektroantrieb also die Zukunft? Die Beteiligten der Diskussionsrunde waren sich einig: Um das herauszufinden und erste Schritte in diese Richtung zu realisieren, ist NRW bestens geeignet: Mit Rhein, Ruhr und einem engen Kanalnetz bildet NRW eine ideale Modellregion.
„Bevor es aber überhaupt zu selbstfahrenden Schiffen auf unseren Flüssen kommt, muss noch viel programmiert und getestet werden. Das Projekt umfasst daher zwei Elemente: Zum einen das Versuchszentrum und zum anderen das Leitungszentrum“, erklärt Professor Dieter Schramm, Inhaber des Lehrstuhls für Mechatronik und Dekan der Fakultät für Ingenieurwissenschaften der Universität Duisburg-Essen.
„Es gibt zwar bereits ein reales Testfeld auf dem Dortmund-Ems-Kanal. Die Vorteile eines Versuchszentrums liegen aber auf der Hand: Die Steuerung kann zunächst in einem Simulator getestet werden, ohne Störungen und Unfälle auf der realen Wasserstraße zu provozieren. Neben etablierten Verfahren werden dabei zur Einschätzung der zukünftigen Manöver benachbarter und entgegenkommender Schiffe auch Methoden der künstlichen Intelligenz zum Einsatz kommen, die lernen, mit unterschiedlichen Situationen umzugehen. Erst dann geht es raus auf die Wasserstraße“, erläutert Professor Dirk Abel, Leiter des Instituts für Regelungstechnik an der RWTH Aachen.
Für einen längeren Zeitraum werden sich konventionelle und autonome Binnenschiffe den Platz auf den Wasserstraßen wohl teilen müssen. Damit es nicht zu Missverständnissen oder Kollision kommt, bedarf es eines Leitungszentrums, ähnlich den Fluglotsen im Flugverkehr. Dieses stellt Daten über Verkehrsteilnehmer, Wasserstraßenverhältnisse, Wassertiefen, Strömungen, Hindernisse, Hochwassersperren, Schleusenausfällen, usw. zur Verfügung. Das Besondere: In Zukunft wird das in zwei ‚Sprachen‘ erfolgen. Das autonome Schiff erhält die Informationen digital. Mit dem Schiffsführer auf dem konventionellen Schiff wird klassisch, z.B. über Funk, kommuniziert. Werden Binnenschiffs-Führer in Zukunft also entbehrlich? „Nicht sofort“, betont Professor Bettar el Moctar, Leiter sowohl des Instituts für Schiffstechnik und Transportsysteme an der Universität Duisburg-Essen als auch des DST. „In einer ersten Phase werden die Binnenschiffe vom Leitungszentrum gesteuert. Dabei sitzt der Schiffsführer bequem im DST und kann das Binnenschiff steuern, das sich auf dem Rhein, in einem Kanal oder irgendwo anders auf der Welt befindet.“
Das Projekt VELABI ist ein Baustein in einer ganzen Reihe von Maßnahmen, die vom Land NRW und vom Bund finanziert werden, um die Binnenschifffahrt zukunftsfähig zu machen. Im Fokus stehen neben der smarten Erforschung autonomer Binnenschiffe auch Umweltaspekte. Binnenschiffe durchfahren besonders in NRW Großstädte, die ohnehin mit Luftschadstoffen zu kämpfen haben. Kann es gelingen, nicht nur autonome, sondern auch emissionsfreie Binnenschiffe auf unseren Wasserstraßen zu etablieren? „Dazu braucht es noch allerhand Forschung“, bekräftigt Dr. Rupert Henn, Geschäftsführer des DST. „Wir sehen eine Aufgabe für die nächsten 10 bis 15 Jahre. Die Einschätzung von Bund und Land, dass es hier Forschungsbedarf gibt, teilen wir natürlich. Die bisher eingeworbenen Projekte sind vielversprechend. Um diese gemeinsam mit unseren vielfältigen Partnern noch besser koordinieren, bündeln und abwickeln zu können, planen wir die Einrichtung eines Kompetenzzentrums. Um Planungssicherheit zu haben, braucht es dafür aber eine Grundfinanzierung. Denn gerade die Kosten, die nicht aus den Projekten bestritten werden können, machen uns zu schaffen“, unterstreicht Henn.
Quelle: Johannes-Rau-Forschungsgemeinschaft e.V., Fotos: JRF e.V./ Alex Muchnik, modellhafter Aufbau des Leitungszentrums im DST, das mit den Fördermitteln des Verkehrsministeriums realisiert werden soll. Platziert: Joachim Zöllner, Koordinator Projektentwicklung am DST