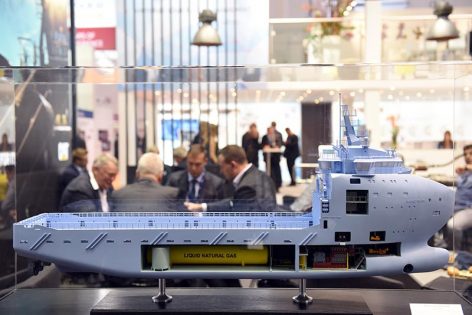Zum zehnten Mal – neun Mal als BranchenForum, nun zum ersten Mal als NetzwerkForum – traf sich die maritime Logistikbranche in Duisburg zum Forum SchifffahrtHafenLogistik von Kompetenznetz Logistik.NRW und dem Verband Verkehrswirtschaft und Logistik (VVWL) in Zusammenarbeit mit der Niederrheinischen Industrie- und Handelskammer Duisburg-Wesel-Kleve. Thema war: „Vernetzte Gütermobilität – Politische Strategien und Herausforderungen für die maritime Logistik“.
„Aus Sicht der Verlader bauchen wir angesichts der ‚vollen‘ Logistiksysteme die Digitalisierung“, so Holger Seifart, Vorsitzender des deutschen Seeverladerkomitees (DSVK) im BDI und Leiter Logistics Europe der Kali und Salz-Gruppe (K +S). Zwar sei auch die Industrie beim Thema „Digitalisierung“ noch nicht da, wo man sein wolle, so Holger Seifart weiter. Lücken existierten z.B. noch im Hinterland mit Blickrichtung Endkunde. Angesichts der guten Konjunktur sei jetzt der richtige Zeitpunkt für Fortschritte. Steven W.A. Lak, Vorsitzender des Rotterdam Port Promotion Councils (RPPC), betonte jeder müsse seine Daten teilen, wenn der Endkunde das verlange. Daniel Hosseus, Hauptgeschäftsführer des Zentralverbandes der deutschen Seehafenbetriebe (ZDS), sieht allerdings schon aus unternehmerischen Gründen Grenzen des Data-Sharings. Das gelte auch für die Idee, die Häfen der Nordwest-Range oder Europas übergreifend zu vernetzen. Die Vernetzungsimpulse gingen von den Bedarfen der einzelnen Unternehmen aus, es gebe keine „Super-Computer-Lösung“ für alle.
Willem van der Schalk, Vorsitzender des Komitees Deutscher Seehafenspediteure (KDS) im DSLV und Geschäftsführer der a. hartrodt (GmbH & Co) KG, forderte, dass die Digitalisierung und Optimierung in der Supply Chain schon beim Bestellvorgang des Kunden des Verladers einsetzen müsse. Eine Information an die Logistikkette schon bei Bestellung würde durch dann rechtzeitig mögliche Prozesse viele aktuelle Probleme lösen. Es gehe beim Thema Digitalisierung letztlich darum, analoge Prozesse in eine digitale Form zu „gießen“. In Hamburg und Bremen existierten mit dbh und Dakosy schon seit Jahren ausgezeichnete Lösungen des Datenaustauschs. Mit z.B. portbase in Rotterdam eröffneten sich auch dort Möglichkeiten. All dies gelte es noch weiter auszubauen. Zudem verweist Willem van der Schalk auf die bereits existierenden, auch Seehäfen übergreifende Netze der Spediteure und dass man als Spediteur mit allen Häfen zusammenarbeite. Die Vernetzung der deutschen Seehäfen habe in der Praxis längst stattgefunden, so Daniel Hosseus. Er verwies etwa auf die drei Standorte von Seehafenbetrieben wie Eurogate.
Philippe Beaujean, Shippers and Forwarders Manager des Hafenbetriebs Antwerpen, schilderte den „Aktionsplan Binnenschifffahrt“ im Hafen Antwerpen, in dem Bündelung und Digitalisierung („Nxt Port“) eine zentrale Rolle spielen und wesentliche Beiträge zur Effizienzsteigerung des Container-Durchlaufs im Hafen leisten sollen. Die Digitalisierung soll bessere Mengen-Forecasts und rechtzeitige Kapazitätsplanungen ermöglichen. Eine Herausforderung sei u.a., dass mehr als 50% der Containermengen pro Schiff, die an den See-Terminals eintreffen, nur bis zu 30 Hübe pro Schiff auslösen, was für diese Terminals problematisch sei. Steven W.A. Lak ergänzte, dass man in Rotterdam an ähnlichen Lösungen wie in Antwerpen zur Lösung der Wartezeitenproblematik für Binnenschifffahrt gearbeitet habe und noch arbeite. Es gäbe nicht „die“ Lösung, sondern nur gemeinsame Lösungen.
Die Turbulenzen in der internationalen Handelspolitik der letzten Monate, insbesondere die Handelspolitik der USA gegenüber Europa und China haben laut Philippe Beaujean und Steven W. A. Lak in ihren Häfen noch nicht zu großen Veränderungen geführt. Dies gelte auch für den Stahlbereich. Insgesamt, so auch Daniel Hosseus, seien vor allem die Entwicklungen des China-Handels und auch die Sorgen um den Brexit von Bedeutung. Der Klimawandel und die Klimapolitik werden in den nächsten 5-10 Jahren zu Veränderungen im Bereich flüssiger Massengüter und bei Energierohstoffen führen, schätzte Steven W. A. Lak ein.
U.a. mit der Formulierung „das Gesamtsystem aus Häfen und Wasserstraßen werden wir durch eine bessere konzeptionelle Vernetzung nachhaltig stärken … Wir wollen digitale Technologien und den automatisierten Betrieb in der Schifffahrt, den Häfen und der maritimen Lieferkette vorantreiben“ ist für Achim Wehrmann, Leiter der Unterabteilung Schifffahrt im Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) der Koalitionsvertrag „ein solides Dach“ für die Verkehrspolitik. Für Unmut im Publikum sorgte, dass die im Koalitionsvertrag zugesagte Streichung der Befahrensabgaben für die Nutzung von Binnenwasserstraßen im Haushaltsentwurf 2019 nicht enthalten ist. Mit der gleichzeitigen Zusage Reduzierung der Trassenpreise der Bahn um 350 Mio. € in 2019 werde so ein falsches Signal gesetzt. Es wird die Zusage erwartet, dass die Befahrensabgaben ab 1.1.2019 nicht mehr erhoben werden. Achim Wehrmann verwies in seiner Antwort u.a. auf das nun anlaufende parlamentarische Verfahren zur Haushaltsgenehmigung.
Das BMVI wolle helfen bei der digitalen Vernetzung, u.a. durch Projekt wie „IHATEC“ (Innovative Hafen-Technologien) und auch durch das Digitale Testfeld Hafen in Hamburg, das bei Funktionieren auch für andere See- oder Binnenhäfen vorstellbar sei. Eine direkte Einmischung in die Vernetzung der Häfen untereinander sei aber nicht das Ziel und die Absicht. Bei aller Notwendigkeit, das Thema „Digitalisierung und Vernetzung“ voranzubringen, spiele aber die traditionelle Infrastruktur noch immer eine sehr große Rolle. Hier stünden die Verstetigung der angewachsenen Investitionsmittel und die tatsächliche Umsetzung der Projekte im Mittelpunkt. Eine Maßnahme sei unter anderem das Planungsbeschleunigungsgesetz. Wichtig sei auch die Entwicklung eines „Innovationsprogramms Logistik“ als Nachfolger der Aktionspläne Güterverkehr und Logistik der letzten Jahre. Hier starten die Prozesse bald, man hoffe hier sehr auf Beiträge von Wirtschaft und Logistik zu den Themen Modernisierung, strategische Forderungen und Innovationen.
Die Erarbeitung des Masterplans Binnenschifffahrt habe Fahrt aufgenommen, noch im September gehe es in die nächste interne Runde. Steven W. A. Lak empfahl, angesichts seiner Bedeutung für die Binnenschifffahrt den Hafen Rotterdam in die Erarbeitung einzubinden. So beschäftige man sich dort im Arbeitskreis Digitalisierung in der Binnenschifffahrt mit Maßnahmen zur Optimierung der betreffenden Logistikketten. Das nationale Hafenkonzept mit seinen rd. 150 Maßnahmen werde kontinuierlich abgearbeitet. Auch dort spielten Themen wie „Vernetzung“ eine Rolle. Etwas schwer tat sich Achim Wehrmann mit einer Definition des Begriffs „Maritime Logistik“, er blieb lieber bei der Bezeichnung „Maritime Wirtschaft“. Kern der Arbeit des Deutschen Maritimen Zentrums bilden Fragen der Gestaltung und Umsetzung von Forschung, Entwicklung und Innovation (FEI) im Bereich der maritimen Wirtschaft. Er sieht diesen Begriff auch nicht auf die Küstenländer beschränkt. So stehe das Deutsche Maritime Zentrum e.V. als nationale Plattform der deutschen maritimen Wirtschaft „für alle, die etwas machen wollen“, offen – auch z.B. für Nordrhein-Westfalen und seine Wirtschaft.
Im „Trialog von Achim Wehrmann mit Michael Viefers, Mitglied des Vorstandes der Rhenus SE & Co. KG, und Jochen E. Köppen, dem Inhaber des Transportlogistikers Köppen GmbH und Vorstandsmitglied des LOG-IT Club e.V., spielten die Leistungsprobleme der digitalen Infrastrukturen eine Rolle. Der Rhenus-Vorstand stellte für die letzten Jahre eine Verschlechterung der Telekom-Infrastruktur „schon beim Telefonieren“ fest, auch im Ballungsraum Rhein-Ruhr. Michael Viefers betonte in diesem Zusammenhang die Unersetzlichkeit leistungsfähiger digitaler Infrastrukturen für Logistikprozesse. Jochen E. Köppen schilderte die besonderen Herausforderungen für einen Mittelständler beim Aufbau von Datenleitungen. Die Fähigkeit zur Datenkommunikation sei heute ein „Muss“. Ohne dazu in der Lage zu sein, drohe man aus dem Markt auszuscheiden.
Hinsichtlich der IT-Vernetzung innerhalb maritimer Logistikketten sieht Michael Viefers derzeit keine Probleme und verwies hier auch auf zu erfüllende Verladerwünsche. Probleme bereiteten hier Überregulierung nicht selten nationaler Art bei eigentlich europäischen Themen wie dem European Train Control System ETCS. Jochen E. Köppen sieht hier durchaus noch Handlungsbedarf bei Unternehmen, hier sei man häufig noch „analog unterwegs“. Positiv für z.B. einen effizienten Fahrereinsatz seien die digitalen Lösungen bei Zeitfensterbuchungen und Abläufen an bestimmten Rotterdamer Terminals. Eine optimale Situation sei für ihn dann erreicht, wenn die Datenströme zeitlich so dem Transportvorgang vorauseilen, dass alle in der Kette Beteiligten sich auf die betreffenden physischen Prozesse rechtzeitig einstellen können.
„Auch wenn die britische Beratungsfirma Transport Intelligence (TI) jüngst zu dem Ergebnis kommt, dass der Markteintritt neuer „digitaler“ Speditionen und Frachtmarktplätze in den vergangene Jahren bislang die Branchenstruktur kaum beeinflusst habe: Wir dürfen bei der digitalen Transformation der eigene Prozesse und der Vernetzung nicht nach lassen. Im Kompetenznetz Logistik.NRW ist daher das Themenfeld Vernetzung/Digitalisierung und Industrie 4.0. weiter ein Schwerpunkt der Innovationsdiskussion“, so der erste Impuls von Dr. Christoph Kösters, Manager des Kompetenznetzes Logistik.NRW und Hauptgeschäftsführer des VVWL. „Wenn die Lkws autonom werden, dann sollten auch das Schiff mit der Entwicklung auf der Straße mithalten, so Ocke Hamann, Geschäftsführer der niederrheinischen Industrie- und Handelskammer Duisburg-Wesel-Kleve. Die IHKs im Ruhgebiet hätten hierzu Gutachten in Auftrag gegeben. Zwar liegen die Ergebnisse noch nicht vor, aber schon jetzt könne gesagt werden, dass die Gutachter die Einrichtung eines Testfeldes für autonome Binnenschiffe, für autonomen Güterverkehr auf der Wasserstraße empfehlen, so Ocke Hamann. Dafür würde sich das „Wasserstraßenland Nr. 1“ NRW gewissermaßen anbieten.
Quelle und Foto: VVWL, v.l. Harald Ehren (Chefredakteur DVZ), Steven W.A. Lak (Vorsitzender Rotterdam Port Promotion Council (RPPC)), Willem van der Schalk (Vorsitzender Komitee Deutscher Seehafenspediteure im DSLV e.V. / Vize-Präsident DSLV e.V.), Holger Seifart (Vorsitzender Deutsches Seeverladerkomitee (DSVK) im BDI / Leiter Logistics Europe der K+S-Gruppe), Daniel Hosseus (Hauptgeschäftsführer Zentralverband der deutschen Seehafenbetriebe (ZDS) e.V.), Philippe Beaujean (Shippers and Forwarders Manager, Hafenbetrieb Antwerpen)