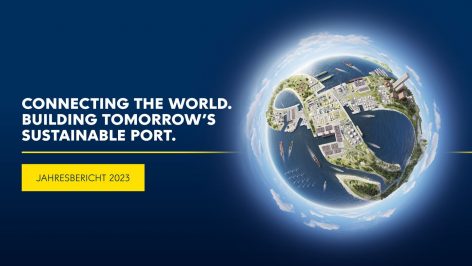Der Antwerpener Bürgermeister Bart De Wever drückte jetzt den symbolischen Startknopf, um das Wärmenetz Antwerpen Nord in Betrieb zu nehmen. Eine Pipelinetrasse durch den Hafen von Antwerpen verbindet den Standort von Indaver Antwerpen mit der Mälzerei Boortmalt. Von nun an tauscht Boortmalt für die Produktion von Malz Erdgas und Kraft-Wärme-Kopplung gegen Abwärme von Indaver ein. Darüber hinaus ist dieses Netz das erste „Open-Access“-Wärmenetz Belgiens, das Möglichkeiten für neue Anbieter und Kunden eröffnet.
Ebenfalls wurde der Anschlusspunkt für ein Netz für soziale Wohngebäude von Woonhaven Antwerpen verlegt. Dieses Wärmenetz bedeutet erhebliche Einsparungen an fossilen Brennstoffen und eine beträchtliche Reduzierung der CO2-Emissionen. Das Projekt wird von der Flämischen Regierung über die Flämische Energie- und Klimaagentur finanziell unterstützt.
„Abwärme“ ist Wärme, die bei einem industriellen Produktionsprozess freigesetzt wird. Ein Wärmenetz mit Abwärme ist eine Alternative zum Heizen mit fossilen Brennstoffen. Es besteht aus einem Netz gut isolierter Leitungen, die Warmwasser für verschiedene Wärmeanwendungen von einem Ort (Industrie) zu einem anderen (Industrie und Haushalte) bringen.
Das Wärmenetz Antwerpen Nord umfasst die Abwärme aus den Drehrohröfen von Indaver, in denen Industrieabfälle thermisch behandelt werden. Die Verbrennungswärme wird in Form von Strom verwertet. Bei diesem Prozess verbleibt eine gewisse Abwärme. Diese Abwärme wird über das Wärmenetz an Boortmalt geliefert, das sich langfristig verpflichtet hat, die Wärme für seinen Mälzungsprozess zu nutzen.
Die Wärme wird mit einer Temperatur von ca. 105 °C über Pipelines von Indaver zu Boortmalt im ca. 10 km entfernten Hafen geleitet. Das abgekühlte Wasser (65 °C) fließt durch eine zweite Rohrleitung zur Wiederverwendung zurück zu Indaver.
Die Mälzerei von Boortmalt in Antwerpen ist die größte der Welt. Mit einer Produktionskapazität von 470.000 Tonnen pro Jahr wird hier das Malz für rund 16 Milliarden Biere pro Jahr hergestellt. Während des Mälzungsprozesses sind große Mengen an Wärme erforderlich. In der Vergangenheit wurde diese Prozesswärme bei der Malzherstellung mit Kraft-Wärme-Kopplungen und Gasbrennern erzeugt. Durch die Nutzung von Abwärme spart Boormalt Erdgas in einer Menge ein, die dem Jahresverbrauch von etwa 10.000 Haushalten entspricht.
Paul De Bruycker, CEO Indaver : „Der erfolgreiche Start des Wärmenetzes Antwerpen Nord unterstreicht einmal mehr die Kraft der Zusammenarbeit zwischen öffentlichen und privaten Einrichtungen. Dieses Projekt spiegelt die tief verwurzelte Mission von Indaver wider, aus Ausschuss einen Mehrwert zu schaffen. Wir liefern die Abwärme aus unseren thermischen Verarbeitungsanlagen über eine Pipeline an Boortmalt und später an die Haushalte. Damit schließen wir den Kreislauf und bieten mit dieser CO2-freien Wärme eine nachhaltige Alternative zur Nutzung fossiler Brennstoffe.“
Nachdem das industrielle Wärmenetz fertiggestellt ist, ist der Weg frei für die Auskoppelung des Wärmenetzes für Wohngebiete. Dieses wird von der Netzgesellschaft Fluvius in den nächsten Jahren gebaut und ermöglicht eine nachhaltigere Gestaltung der Wärmeversorgung von Schulen, öffentlichen Gebäuden und 3.200 Familien in zwei Bezirken im Norden Antwerpens.
Guy Cosyns, Direktor Kundenservice und Datenmanagement bei Fluvius: „In aktiver Zusammenarbeit mit verschiedenen Stakeholdern wie Wärmeerzeugern, Wärmelieferanten, Studienbüros usw. setzt sich Fluvius für die Realisierung eines stadtweiten Wärmenetzes in Antwerpen ein, das sich auf verschiedene Wärmecluster in der Stadt verteilt, darunter auch das Wärmecluster Antwerpen Nord. In Kürze werden wir mit dem Bau des Wärmenetzes in den Stadtteilen Luithagen, Rozemaai und Luchtbal beginnen, an das wir nicht nur Schulen und öffentliche Gebäude, sondern auch die Wohngebäude des Wohnungsunternehmens Woonhaven mit insgesamt 3.200 angebundenen Haushalten anschließen werden.“
Die Umstellung von fossilen Brennstoffen auf Abwärme bedeutet eine Verringerung der CO2-Emissionen um 80.000 Tonnen pro Jahr (wenn die volle Kapazität des Wärmenetzes genutzt wird). Dies entspricht den jährlichen CO2-Emissionen von 25.000 Antwerpener Haushalten.
Das Besondere an diesem Netz ist, dass es das erste „Open-Access“-Wärmenetz in Belgien sein wird. Jedes Unternehmen im Hafen, das Wärme produziert und/oder abnehmen möchte, kann sich anschließen. Das Leitungsnetz verläuft unter anderem entlang der Standorte des sogenannten „Next-Gen District“. Der Port of Antwerp-Bruges wird Unternehmen, die in der Kreislaufwirtschaft tätig sind, an diesem Standort bündeln. Diese Unternehmen können dann ihrerseits zusätzliche Abwärme in das Netz einspeisen oder aus dem Netz entnehmen.
Jacques Vandermeiren, CEO Port of Antwerp-Bruges: „Heute führt das Wärmenetz des Wärmenetz Antwerpen Nord zu einer echten Verringerung der CO2-Emissionen, und zwar dank der Zusammenarbeit zwischen Hafen, Industrie und Stadt. Die langfristige Verpflichtung und der ständige Wärmeaustausch zwischen Industrieunternehmen im Hafen von Antwerpen wie Indaver und Boortmalt ermöglichen die Entwicklung eines größeren Wärmenetzes. Damit können auch Schulen, große Gebäude und 3.200 Wohnungen in Antwerpen zeitnah klimafreundlich mit Wärme versorgt werden. Als einziges Wärmenetz in Belgien ermöglicht das Netz auch eine künftige Erweiterung um weitere Wärmelieferanten und -abnehmer. Wir sind daher stolz auf diesen wichtigen Schritt in der Energiewende.“
Um die mehr als 3.200 Sozialwohnungen mit klimafreundlicher Wärme zu versorgen und den industriellen Wärmeverbraucher bei seinen Nachhaltigkeitsplänen zu unterstützen, war eine Zusammenarbeit mit zahlreichen Partnern notwendig. Indaver und der Port of Antwerp-Brugesbauten gemeinsam den ersten Abschnitt der Leitung, die Boortmalt nun mit Wärme versorgt. Ausgehend von diesem industriellen Wärmenetz wird Fluvius im Auftrag von und in Zusammenarbeit mit der Stadt Antwerpen das zweite Netz für Wohngebäude bauen. Zu diesem Zweck wurden Vereinbarungen u. a. mit dem sozialen Wohnungsunternehmen Woonhaven Antwerpengeschlossen. Schließlich ist die Flämische Regierung durch die finanzielle Unterstützung, die das Projekt erhielt, ein wichtiger Partner. Der Zuschuss ist Teil des Ziels, die Abkopplung der Abwärme und den Ausbau von Wärmenetzen zu fördern.
Bart De Wever, Bürgermeister Antwerpen: „Das Warmtenet Antwerpen Noord ist aus vielen Gründen ein Erfolg“, sagt Bürgermeister Bart De Wever. „Das Fernwärmenetz ist die perfekte Kombination aus industrieller Entwicklung, nachhaltigen Lösungen und sozialen Zielen. Das Beste an der ganzen Geschichte ist, dass wir dies mit einer Ressource erreichen, die wir zwar schon hatten, deren Potenzial wir aber noch nicht voll ausschöpfen konnten. Das ändert sich jetzt. Mit der Abwärmenutzung zeigen wir, dass unsere Industrie eine Vorreiterrolle bei der Erreichung unserer Klimaziele einnehmen und gleichzeitig nachhaltige Innovationen vorantreiben kann. Das ist nicht nur gut für die Umwelt, sondern auch für unseren Wohlstand.“
Yvan Schaepman, CEO Boortmalt : „Es ist großartig, zu sehen, wie stark die Teams sind, wenn alle Beteiligten an einem Strang ziehen. Das Heatloop-Projekt in Antwerpen ist das weltweit größte CO2-Einsparungsprojekt von Boortmalt. Das ist beeindruckend und wir sind auf dem besten Weg unser Ziel, bis 2035 klimaneutral zu sein, zu erreichen.“
Tatjana Scheck, Schöffin für Umwelt und Soziales in Antwerpen: „Das Wärmenetz Nord zeigt, dass die Klimapolitik von Antwerpen gleichzeitig auch Sozialpolitik ist. Mehr als 3.000 Sozialwohnungen in Luchtbal und Roozemaai werden bald klimaneutral beheizt werden. Erneuerbare Wärme ist kein Privileg für uns, sondern sollte so vielen Haushalten wie möglich zur Verfügung stehen.“
Wouter Gehre, Geschäftsführer Woonhaven Antwerp: „Durch das künftige Wärmenetz im Norden der Stadt kann Woonhaven Antwerpen ein CO2-freies Heizsystem für rund 3.200 Familien in Rozemaai und Luchtbal garantieren, das einfach zu nutzen ist.“
Quelle: Port of Antwerp-Bruges