Gutachten zum Schifffahrtsstandort
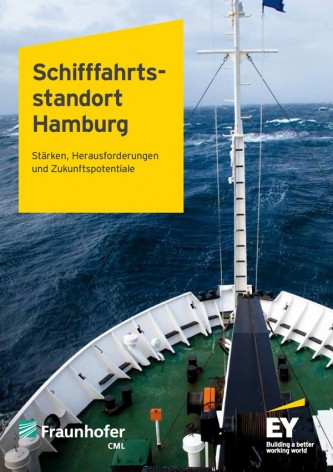
Die Seeschifffahrt hat international und für den Wirtschaftsstandort Deutschland eine hohe Bedeutung. Hamburg zählt zu den weltweit führenden Schifffahrtsstandorten und kann diese Position behaupten, so das Ergebnis des Gutachtens „Schifffahrtsstandort Hamburg – Stärken, Herausforderungen und Zukunftspotentiale“, das Senator Frank Horch mit den Gutachtern von Ernst & Young und dem Fraunhofer CML vorstellte.
Basis dieser Einschätzung ist eine detaillierte Analyse der Schifffahrt in Hamburg. Betrachtet wurden dabei Reedereien, Schiffsmakler- und -agenten, Schiffsfinanzierer sowie schifffahrtsbezogene Dienstleister und Institutionen. Auswirkungen der anhaltenden Schifffahrtskrise zeigen sich auch am Standort Hamburg. Gleichwohl erwirtschaften mehr als 23.550 Beschäftigte in 460 Unternehmen geschätzte 4,1 Mrd. Euro Wertschöpfung. Vor allem die große Vielfalt und Dichte an Unternehmen und Institutionen in allen Teilbereichen der Seeschifffahrt kennzeichnen den Standort. National ist Hamburg klar der stärkste Standort. Im internationalen Ranking steht Hamburg hinter Singapur auf Rang 2 vor Rotterdam und Oslo.
Die Gutachter gehen davon aus, dass Hamburg seine Position als qualitativ hochwertiger Schifffahrtsstandort behaupten kann und identifizieren hierfür zentrale Herausforderungen und Handlungsoptionen. Dazu zählen insbesondere Kapitalaufbringungsstrukturen von Reedereien. Ein aktives Angehen und Umsetzen dieser Herausforderungen ist bereits in verschiedenen Bereichen gelungen. Gleichzeitig sehen die Gutachter nach dem Wegfall des KG-Modells weiteren Handlungsbedarf für neue Wege zur Einwerbung von Eigenkapital und fordern hierzu zwingend privatwirtschaftliches Engagement.
Auch bei Forschung und Entwicklung, Personal, regionalen Rahmenbedingungen und Standortmarketing sehen die Gutachter Ansatzpunkte, um Impulse zur Stärkung des Standorts zu geben. Insgesamt schlagen die Gutachter als Konsequenz ihrer Analysen 17 Maßnahmen vor, die geeignet sind, Beiträge zur Sicherung der Zukunftsfähigkeit des Schifffahrtsstandortes Hamburg zu leisten.
Senator Frank Horch: „Das Gutachten zeigt eindrucksvoll, wie stark und bedeutend die Schifffahrt in Hamburg ist. In die Erstellung des Gutachtens sind zentrale Akteure der Hamburger Schifffahrtsbranche einbezogen worden. Dieser fortlaufende Dialog ist uns wichtig. Zur Sicherung der Zukunftsfähigkeit des Schifffahrtsstandortes Hamburg appelliere ich an alle Akteure, ihre vielfältigen Anstrengungen fortzuführen und sich intensiv für eine positive Entwicklung einzusetzen.“
Das Gutachten „Schifffahrtsstandort Hamburg – Stärken, Herausforderungen und Zukunftspotentiale“ ist im Internet hier verfügbar.
Quelle und Foto: Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation








