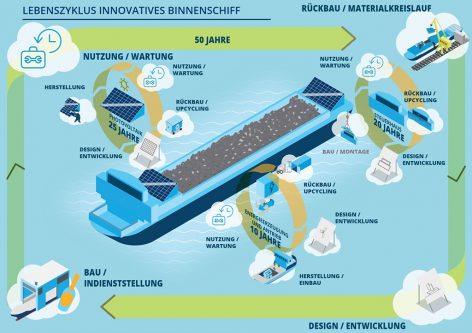PSA steigt bei Duisburg Gateway Terminal ein

Der weltweit tätige Hafen- und Logistikkonzern PSA International Pte Ltd (PSA) mit Hauptsitz in Singapur hat Verträge zum Erwerb einer Minderheitsbeteiligung von 22 Prozent an der Duisburg Gateway Terminal GmbH (DGT) unterzeichnet. Die hierzu getroffenen Vereinbarungen stehen noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung der zuständigen Wettbewerbs- und Aufsichtsbehörden. Mit Vollzug der Verträge ist der internationale Gesellschafterkreis mit Hupac, HTS, duisport und PSA dann komplett.
Mit dem DGT entsteht im Duisburger Hafen das größte und erste 100 Prozent klimaneutrale Containerterminal im europäischen Hinterland.
„Wir freuen uns mit PSA einen wichtigen strategischen Partner für die DGT-Gesellschaft dazugewonnen zu haben, der mit seinen verschiedenen Geschäftsfeldern in Europa, Asien und weltweit erheblich zum Erfolg des Duisburg Gateway Terminals beitragen wird. Diese Netzwerkerweiterung stärkt sowohl die Wettbewerbsvielfalt als auch die weitere Diversifizierung des Duisburger Hafens. Das Thema Lieferkettendiversifizierung hat eine zunehmend wichtige Bedeutung“, sagt duisport-CEO Markus Bangen.
Tan Chong Meng, CEO der PSA-Gruppe, sagt: „Wir freuen uns, neben den bestehenden Gesellschaftern duisport, Hupac und HTS Partner des Duisburg Gateway Terminal zu werden. Als Teil von Europas größtem und nachhaltigstem Binnenhafen wird das DGT ein wichtiges Tor für die Bereitstellung umweltfreundlicher Logistikdienstleistungen für das dichte industrielle Hinterland Deutschlands sein. Durch die Nutzung des globalen Hafen- und Lieferkettennetzes von PSA sowie der starken Präsenz in Kontinentaleuropa will PSA die Partnerschaft mit dem DGT stärken und die grüne Energiewende in Deutschland im Einklang mit unserer strategischen Ausrichtung auf einen reibungsloseren, widerstandsfähigeren und nachhaltigeren Handel unterstützen.“
Das trimodale DGT ist weiter planmäßig in Bau. Es gilt als Modellprojekt für die Zukunft der Logistik und wird mit einer Fläche von 235.000 Quadratmetern im Endausbau das größte Containerterminal im europäischen Hinterland sein. Die Fertigstellung des ersten Bauabschnitts soll im ersten Quartal 2024 erfolgen.
Quelle und Grafik: duisport, mit dem DGT entsteht im Duisburger Hafen das größte und erste 100 Prozent klimaneutrale Containerterminal im europäischen Hinterland. PSA International Pte Ltd hat nun Verträge zum Erwerb einer Minderheitsbeteiligung von 22 Prozent an der Duisburg Gateway Terminal GmbH unterzeichnet.