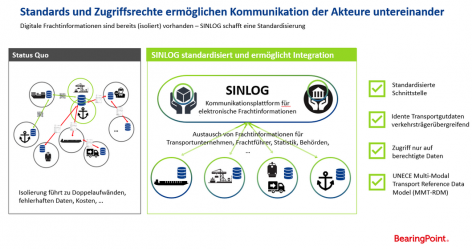LNG-Import über geplantes Terminal in Brunsbüttel

Im Zuge der jüngsten Entwicklungen zum Bau eines Energieterminals in Brunsbüttel wurde jetzt ein Memorandum of Understanding (MoU) zwischen der German LNG Terminal GmbH und Shell für den Import von LNG über das Terminal unterzeichnet. Die Vereinbarung sieht vor, dass Shell einen substanziellen Teil der Kapazität des Terminals in Brunsbüttel für den Import von LNG langfristig bucht. Beide Seiten arbeiten derzeit daran, Umfang und Dauer der Partnerschaft möglichst schnell vertraglich bindend zu vereinbaren.
„Das unterschriebene MoU mit Shell sowie das spürbar gesteigerte Interesse des Marktes zeigen die Bedeutung des Importterminals in Brunsbüttel“, so Dr. Michael Kleemiß, Geschäftsführer von German LNG Terminal. „Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Shell als weiteren Partner in den kommenden Jahren und werden alles daransetzen, Planung und Umsetzung zügig voranzutreiben. Das Terminal wird dabei nicht nur zur Energieversorgungssicherheit in Deutschland, sondern perspektivisch auch zur notwendigen klimaneutralen Energieversorgung beitragen.“
Fabian Ziegler, Geschäftsführer von Shell in Deutschland: „Ich freue mich über unsere Vereinbarung mit German LNG Terminal. Sie ist ein wichtiger Schritt, um kurzfristig die Versorgung in Deutschland und darüber hinaus in ganz Europa sicherzustellen. LNG ist die flexibelste Form der Gasversorgung, die schnell an sich verändernde Handelsstrukturen angepasst werden kann. Unser vielfältiges und flexibles globales Lieferportfolio ermöglicht es uns, LNG effizient dorthin zu liefern und zu importieren, wo es am meisten gebraucht wird. Mit LNG tragen wir zur Deckung des Energiebedarfs und zur Begrenzung der CO2-Emissionen bei – ein wesentlicher Faktor bei der Energiewende. Erdgas ist der am saubersten verbrennende Kohlenwasserstoff, zudem soll das Terminal zukünftig auch auf Wasserstoff oder Wasserstoffderivate wie Ammoniak umgerüstet werden können.“
German LNG Terminal plant den Bau und Betrieb eines kombinierten Import- und Distributionsterminals für LNG in Brunsbüttel. Die Planungen gehen dabei von einer jährlichen Durchsatzkapazität von 8 bcm (Erdgas) aus. Das Terminal wird aus zwei Tanks à 165.000 m³ für die Zwischenspeicherung von LNG, einer Jetty mit zwei Anlegemöglichkeiten für LNG Carrier (bis zur Größe QMax) und kleinere LNG Schiffe sowie Anlagen zum Löschen und Beladen der Schiffe, Regasifizierungsanlagen für Rückwandlung in einen gasförmigen Aggregatzustand und die nachfolgende Einspeisung in das deutsche Hochdruckerdgasnetz sowie Anlagen zur Verladung auf Tanklastwagen, Eisenbahnkesselwagen und LNG Bunkerschiffe für die Distribution bestehen.
Des Weiteren wird der zukünftige Import von Wasserstoff bzw. Wasserstoffderivaten von Beginn an berücksichtigt, um geeignete Anlagenkomponenten bereits auf den potenziellen Import von alternativen Energieträgern vorzubereiten.
Die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) im Auftrag der deutschen Bundesregierung, die in niederländische Gasunie LNG Holding B.V. (eine Tochtergesellschaft der staatseigenen N.V. Nederlandse Gasunie) und RWE hatten Anfang März ein Memorandum of Understanding unterzeichnet, um den der Bau und Betrieb eines multifunktionalen Import- und Distributionsterminals für verflüssigtes Erdgas (Liquefied Natural Gas, LNG) in Brunsbüttel gemeinsam voranzutreiben. Betreiberin des LNG-Terminals wird Gasunie.
Die so gewählte Gesellschafterkonstruktion mit überaus erfahrenen Unternehmen stellt nicht nur die möglichst zügige Fertigstellung des Projektes, sondern auch die sukzessive Nutzung für klimaneutrale Energieträger sicher. Es ist von Beginn an vorgesehen, das Terminal für den Import von grünem Wasserstoff bzw. seinen Derivaten umrüstbar zu gestalten.
Quelle und Foto: Shell plc