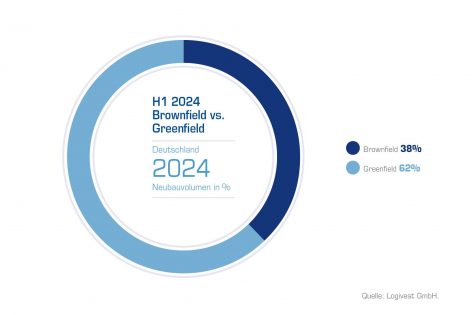Die strukturellen Schwächen des Schienennetzes in Deutschland und die angespannte betriebliche Lage, auch infolge von Streiks und Extremwetter, haben die wirtschaftliche Entwicklung der Deutschen Bahn (DB) im ersten Halbjahr 2024 negativ beeinflusst. Damit dringend nötige Reparaturen an der Infrastruktur zügig beginnen konnten, ist die DB wie schon im ersten Halbjahr 2023 zudem mit erheblichem zusätzlichem Aufwand in Vorleistung gegangen.
Der DB-Konzern schloss das erste Halbjahr 2024 mit einem operativen Verlust (EBIT bereinigt) von minus 677 Millionen Euro ab – mehr als 950 Millionen schlechter als im ersten Halbjahr 2023. Das Konzern-Ergebnis nach Ertragssteuern betrug minus 1,2 Milliarden Euro (1. Halbjahr 2023: minus 71 Millionen Euro). Die weiterhin sehr positiven Ergebnisbeiträge der hochprofitablen Logistik-Tochter DB Schenker konnten die Verluste im Kerngeschäft der DB nur teilweise ausgleichen. Der Systemverbund Bahn verzeichnet im ersten Halbjahr 2024 einen operativen Verlust von minus 1,2 Milliarden Euro (erstes Halbjahr 2023: minus 339 Millionen Euro). Der Umsatz des DB-Konzerns sank leicht um drei Prozent auf 22,3 Milliarden Euro.
Der DB-Konzern hat seine Investitionen in das Schienennetz und in eine bessere Bahn im ersten Halbjahr 2024 aufgrund stark erhöhter Bundesmittel erneut gesteigert und setzt so die Ausbau-Strategie für eine Starke Schiene in Deutschland weiter konsequent um. Die Netto-Investitionen sind gegenüber dem ersten Halbjahr 2023 um rund 35 Prozent auf 4 Milliarden Euro gestiegen. Die Brutto-Investitionen haben 7,3 Milliarden Euro erreicht – ein Plus von 18 Prozent. Trotz der Verluste im ersten Halbjahr hält die DB an dem Ziel fest, ihr operatives Ergebnis im Systemverbund Bahn im Gesamtjahr 2024 gegenüber dem Vorjahr um rund 2 Milliarden Euro zu verbessern und bestätigt grundsätzlich ihre Prognose für den Konzern. Dazu beitragen soll auch die neue Aufwandsförderung für Instandhaltungsmaßnahmen, die der Bund im zweiten Halbjahr 2024 umsetzen will. Dies umfasst Mittel für bereits geleisteten Instandhaltungsaufwand in 2023 und in 2024. Zugleich setzt die DB ihre Maßnahmen zur Kostensenkung und Verbesserung der Effizienz vor allem in der Verwaltung fort.
„Extremwetterereignisse in nie dagewesenem Ausmaß haben die ohnehin sanierungsbedürftige Schieneninfrastruktur an die Grenze ihrer Leistungsfähigkeit gebracht und die betriebliche und finanzielle Lage im Personen- und Güterverkehr verschärft. Dazu kamen Streiks und Havarien wie der Rauhebergtunnel“, sagt DB-Vorstandsvorsitzender Dr. Richard Lutz. „Im Fernverkehr hat uns das in Summe im ersten Halbjahr rund 7 Prozentpunkte Pünktlichkeit gekostet und zusätzlich die Nachfrage gedämpft. Trotz dieser Belastungen wollen wir im Gesamtjahr 2024 im DB-Konzern operativ wieder schwarze Zahlen schreiben. Deshalb haben wir neben der Sanierung der Infrastruktur auch kurzfristige Maßnahmen zur Stabilisierung der betrieblichen und der wirtschaftlichen Lage eingeleitet“, betont Lutz.
Mit dem Aktionsplan Pünktlichkeit treibt die DB etwa in besonders stark ausgelasteten Knoten den planmäßigen Beginn von Fahrten voran. Um die wirtschaftliche Lage kurzfristig zu verbessern, setzt der Systemverbund Bahn eine qualifizierte Ausgabensteuerung um. So hat die DB bisher rund 110 Millionen Euro Sachaufwand eingespart. Hinzu kommen mittel- und langfristige Maßnahmen zur Steigerung der Profitabilität in allen Bereichen des Systemverbunds Bahn.
Die störanfällige Infrastruktur, hohe Bautätigkeit und eine gesunkene Pünktlichkeit (im Fernverkehr 62,7 Prozent, 1. Halbjahr 2023: 68,7 Prozent) haben in den ersten sechs Monaten 2024 Leistung, Umsatz und Ergebnis der DB-Eisenbahnverkehrsunternehmen stark beeinträchtigt. Die Betriebsleistung auf dem Schienennetz verringerte sich in den ersten sechs Monaten 2024 gegenüber dem Vorjahreszeitraum leicht um 1,8 Prozent auf 548 Millionen Trassenkilometer.
64,2 Millionen Reisende nutzten im ersten Halbjahr 2024 die Fernverkehrszüge der DB – rund sechs Prozent weniger als in den ersten sechs Monaten des Vorjahres. Die Verkehrsleistung des Fernverkehrs sank wegen der Streiks und der auch wetterbedingten Einschränkungen im Schienennetz im gleichen Zeitraum um 3,6 Prozent auf rund 20,9 Milliarden Personenkilometer.
Die weißen Züge der DB fuhren im ersten Halbjahr mit 2,8 Milliarden Euro insgesamt rund 68 Millionen Euro weniger Umsatz als im Vorjahreszeitraum ein. Nach den von Streiks geprägten ersten Monaten des Jahres kehrten die Reisenden zuletzt in hoher Zahl in die Züge zurück und machten den Juni 2024 zum umsatzstärksten Monat in der Geschichte des Fernverkehrs. DB Fernverkehr schloss das Halbjahr 2024 mit einem operativen Verlust (EBIT bereinigt) von minus 232 Millionen Euro ab (erstes Halbjahr 2023: minus 62 Millionen Euro).
DB Regio verzeichnete im ersten Halbjahr 2024 weiterhin deutlich positive Auswirkungen des Deutschland-Tickets: 855 Millionen Passagiere reisten im ersten Halbjahr 2024 mit den Nahverkehrszügen der DB – ein Plus von rund sechs Prozent gegenüber den ersten sechs Monaten 2023. Sie fuhren zudem erheblich längere Strecken: Die Verkehrsleistung bei DB Regio Schiene stieg um mehr als 17 Prozent auf 19,5 Milliarden Personenkilometer. Der Umsatz von DB Regio legte um 283 Millionen Euro auf rund 5,0 Milliarden Euro zu. Das operative Ergebnis (EBIT bereinigt) blieb mit minus 66 Millionen Euro (erstes Halbjahr 2023: minus 37 Millionen Euro) leicht negativ.
Die Schienengüterverkehrstochter DB Cargo, die sich mitten in einer umfassenden Transformation befindet, beförderte im ersten Halbjahr 2024 etwa 93 Millionen Tonnen Fracht – rund 10,2 Prozent weniger als in den ersten sechs Monaten 2023. Auch aufgrund geringerer Produktion energieintensiver Industrien und konjunkturell bedingt geringerer Transportnachfrage, sank die Verkehrsleistung um 7,6 Prozent und der Umsatz um 106 Millionen Euro auf 2,8 Milliarden Euro. Darüber hinaus belasteten die Auswirkungen der Streiks und geringere Trassen- und Anlagenpreisförderungen. Das operative Ergebnis (EBIT bereinigt) verschlechterte sich gegenüber den ersten sechs Monaten 2023 um 66 Millionen Euro auf minus 261 Millionen Euro. Die vom Bund neu eingeführte Förderung des Einzelwagenverkehrs für die gesamte Branche greift erstmalig im zweiten Halbjahr.
Die Logistik-Tochter DB Schenker hat sich trotz der weiteren Normalisierung der Frachtraten in der Luft- und Seefracht auch im ersten Halbjahr 2024 sehr gut entwickelt. Mit 520 Millionen Euro operativem Gewinn (EBIT bereinigt) war das Ergebnis von DB Schenker weiterhin im Vergleich zum Vor-Corona-Niveau mehr als doppelt so hoch. „Dank eines erfolgreichen Effizienzprogramms hat DB Schenker gute Chancen, auch in Zukunft weitere Potenziale beim Ergebnis zu heben“, sagt DB-Finanzvorstand Dr. Levin Holle.
In ihrem Kerngeschäft treibt die DB ebenfalls strukturelle Veränderungen voran, um über mehr Standardisieren, Automatisieren und Digitalisieren effizienter zu arbeiten. „Alle Geschäftsfelder des Systemverbunds Bahn müssen wieder profitabel werden. Hierzu müssen wir die Kosteneffizienz deutlich verbessern“, so Holle. Die wirtschaftlichen Belastungen aus Streiks im ersten Halbjahr beziffert er auf rund 300 Millionen Euro.
Die DB konzentriert sich insgesamt stärker auf ihr Kerngeschäft. Wie geplant hat sie im Mai 2024 den Verkauf von DB Arriva abgeschlossen. Die Verschuldung des DB-Konzerns hat sich damit um mehr als eine Milliarde Euro reduziert.
Der von der Bundesregierung beschlossene deutliche Ausbau der Unterstützung für die Schiene ist im Juni mit der Auszahlung der ersten Tranche der für 2024 geplanten Eigenkapitalerhöhungen für die DB in Höhe von rund drei Milliarden Euro angelaufen. Das stabilisiert die Verschuldung des DB-Konzerns. Die Netto-Finanzschulden der DB sanken per 30. Juni 2024 um rund eine Milliarde Euro im Vergleich zum Vorjahresende.
Im zweiten Halbjahr setzt die DB alles daran, die gestartete Generalsanierung der Riedbahn zwischen Frankfurt/Main und Mannheim erfolgreich umzusetzen und damit den Umbau des hochbelasteten Netzes in ein Hochleistungsnetz einzuleiten. Mit der Sanierung der Strecke zwischen Frankfurt/Main und Mannheim werden dort Störungen durch die Infrastruktur um bis zu 80 Prozent reduziert.
Ab sofort plant die DB auch über die großen Hauptkorridore hinaus Baustellen anders. In festgelegten Zeitfenstern wird das Bauen gebündelt und das Bauvolumen erhöht. Das schafft mehr baufreie Zeiten und steigert die Verlässlichkeit für Verkehrsunternehmen und Fahrgäste.
Für das Gesamtjahr 2024 hält der DB-Konzern grundsätzlich an seinem Ausblick vom März fest, mit kleineren Anpassungen nach unten. Die Investitionen in eine leistungsfähige Infrastruktur sollen 2024 auf einem sehr hohen Niveau weiter steigen: Die Brutto-Investitionen für das Gesamtjahr auf ungefähr 21 Milliarden Euro und die Netto-Investitionen unter Einbeziehung der Eigenkapitalerhöhung des Bundes auf rund elf Milliarden Euro.
Die Umsatz-Prognose wurde mit rund 45 Milliarden Euro leicht abgesenkt auf das Niveau des Vorjahres. Für das Gesamtjahr 2024 will der DB-Konzern einen operativen Gewinn (EBIT bereinigt) in Höhe von etwa einer Milliarde Euro erwirtschaften.
Alle Prognosen sind unter anderem abhängig von der Entwicklung der betrieblichen Lage sowie vom weiteren Zufluss erwarteter Bundesmittel.
Quelle und Foto: Deutsche Bahn