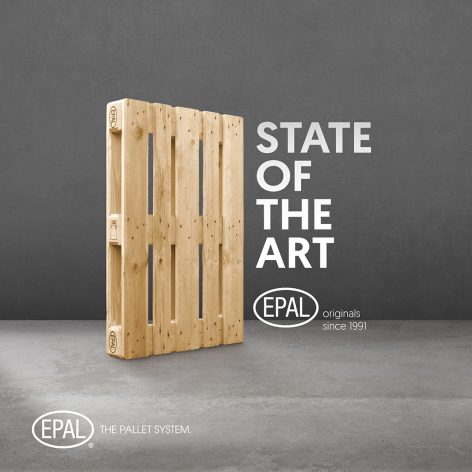Unternehmen, die ihre Güter per Schiff importieren oder exportieren, haben in der Regel wenig Einfluss auf die Treibstoffwahl der (Container-)Reederei. GoodShipping ändert dies mit dem Konzept namens „Insetting“. Der Hafenbetrieb Rotterdam und GoodShipping führen gemeinsam eine Kampagne durch, damit Unternehmen dieses Konzept kennenlernen können und ihre Seefracht – oder einen Teil davon – mit nachhaltigem Treibstoff transportieren lassen können.
Ziel der Kampagne „Switch to Zero“ ist es, ungefähr zwanzig Seefrachtverlader dafür zu gewinnen. Swinkels Family Brewers, bekannt unter anderem für seine Marken Bavaria und Cornet, sowie Dille & Kamille sind die ersten, die ihre Teilnahme an dieser Kampagne angekündigt haben. Sie werden nächstes Jahr (einen Teil) ihrer Container mit nachhaltigem Treibstoff transportieren lassen.
Beim „Insetting“ wird die CO2-Reduktion nicht durch Kompensation („Offsetting“, beispielsweise durch das Pflanzen von Bäumen) erreicht, sondern durch die Verwendung von nachhaltigem Treibstoff durch die Schifffahrtsindustrie selbst. Verlader, die häufig eine kleine Anzahl von Containern auf verschiedenen Schiffen transportieren lassen, können durch das „Insetting“ über GoodShipping eine bestimmte Menge an CO2-Reduktion erwerben. GoodShipping sorgt dafür, dass dies umgesetzt wird, indem ein Schiff mit nachhaltigem Treibstoff versorgt wird. Dazu braucht es nicht dasselbe Schiff zu sein, auf dem der Containertransport erfolgt.
Als Anreiz für die Logistikbranche, CO2 zu sparen, wollen GoodShipping und der Hafenbetrieb Rotterdam etwa zwanzig neue Seefrachtverlader finden, die bereit sind, diesen Service zu nutzen. Die Kampagne bietet eine unkomplizierte Möglichkeit, sich zu beteiligen und zu einer konkreten Reduzierung der CO2-Emissionen beizutragen. Das Ziel lautet, gemeinsam mit diesen Verladern ein Schiff zu bunkern, so dass 2023 Tonnen weniger CO2 in die Atmosphäre gelangen. Dies lässt sich mit der Menge an CO2 vergleichen, die beim Transport von ca. 15.000 TEU Containern zwischen Rotterdam und Göteborg freigesetzt wird.
Allard Castelein, CEO des Hafenbetriebs Rotterdam: „Die Schifffahrt liegt noch nicht gut im Zeitplan, bis 2050 kohlendioxidneutral zu sein. Gemeinsam mit Partnern entwickeln wir eine Reihe von Initiativen, die dazu beitragen sollen, die Logistik nachhaltiger zu gestalten: von der batteriebetriebenen Binnenschifffahrt bis hin zur Landstromversorgung von Seeschiffen und von der Bio-Kerosin-Produktion für die Luftfahrt bis hin zu den sogenannten Green Corridors (grünen Korridoren) für die Schifffahrt. Die Reduzierung in Höhe von 2023 Tonnen CO2 durch nachhaltigen Treibstoff ist dabei nur ein Beginn. Wir wollen zeigen, dass es möglich ist und dabei die Diskussion in Gang bringen. Das Ziel lautet Maßstabsvergrößerung und eine immer stärkere CO2-Senkung. Das Tempo beim Wandel muss erhöht werden.“
Dirk Kronemeijer, CEO Dirk Kronemeijer, CEO GoodShipping: „Wir haben in den letzten zwei Jahren eine enorme Beschleunigung der Energiewende bei den Verladern feststellen können, und deshalb wollen wir mehr Unternehmen die Möglichkeit geben, ihre Fracht nachhaltig zu transportieren. Das Angebot des Hafenbetriebs Rotterdam, der als nachhaltigster Hafen der Welt gelten will, hierbei mitzuwirken, war daher eine einfache Entscheidung. Mit der „Switch to Zero“-Kampagne machen wir es den Unternehmen leicht, ihre Transporte ohne komplizierte Änderungen in der Lieferkette nachhaltiger zu gestalten.“
Harold Reusink, Supply Chain Manager Dille & Kamille: „Bei Dille & Kamille streben wir danach, unser Sortiment noch nachhaltiger zu gestalten. Aus diesem Grunde arbeiten wir im Hinblick auf unsere Übersee-Transporte mit GoodShipping zusammen. Das Großartige an dieser Zusammenarbeit ist, dass sie auch andere dazu inspiriert, sich mit den Möglichkeiten für mehr Nachhaltigkeit zu beschäftigen. So entsteht eine Kettenreaktion innerhalb einer Kette, die ursprünglich eher konservativ ist, einfach dadurch, dass neue Fragen rund um die Organisation des Transports gestellt werden.“
Fred Hooft, Global Logistics Manager bei Swinkels Family Brewers: „Wir haben den Ehrgeiz, als Unternehmen vollständig kreislauffähig zu werden. In diesem Zusammenhang interessieren uns natürlich auch die CO2-Emissionen unseres Transports. Die „Switch to Zero“-Kampagne ist ein guter erster Schritt, um herauszufinden, wie wir unseren Seetransport nachhaltiger gestalten können. Wir hoffen, dass diese Initiative mehrere Unternehmen dazu bewegen wird, den Schritt zu wagen, und dass wir gemeinsam etwas Entscheidendes für die Reduzierung der Umwelt- und Klimabelastung tun können.“
Die Kampagne von GoodShipping und dem Hafenbetrieb Rotterdam, die rund zwanzig Verlader zur Teilnahme bewegen soll, beginnt am 5. Dezember, wobei sich Dille & Kamille und Swinkels Family Brewers bereits als Teilnehmer angemeldet haben. Teilnehmende Unternehmen können sich für eine Reduktion von 75, 100 oder 125 Tonnen CO2 entscheiden. GoodShipping und der Hafenbetrieb bieten einen beträchtlichen Rabatt pro Tonne CO2-Reduktion, was es für Unternehmen attraktiv macht, dieses Konzept auszuprobieren.
Die Schifffahrt ist für etwa 3 % der weltweiten CO2-Emissionen verantwortlich, ist aber gleichzeitig ein komplexer Sektor, der lange Zeit aus den internationaler Klimaabkommen herausfiel. Außerdem ist die Kette bruchstückhaft, weil die Unternehmen oft nur einige wenige Container per Schiff transportieren.
Das niederländische Unternehmen GoodShipping ist Weltmarktführer im Bereich „Insetting“, dem Service für Verlader und Produzenten, die Seefracht mit nachhaltigem Treibstoff anstelle von herkömmlichem, fossilem Treibstoff transportieren lassen. Durch diese Form des „Insetting“ wird die Energiewende im Transportsektor beschleunigt. Die Initiative liegt hierbei nicht bei den Reedereien, sondern bei den Ladungseignern. GoodShipping ist bereits für große Akteure wie DHL, IKEA, BMW, Tony’s Chocolonely, Beiersdorf und Kings of Indigo tätig. Der Treibstoff wird aus zertifizierten nachhaltigen Energieströmen hergestellt, zu denen auch Frittierfett und tierische Fette gehören, die als 100%ige Abfälle gekennzeichnet sind und nicht weiter verwendet werden können. Außerdem konkurrieren diese sogenannten modernen Biokraftstoffe nicht mit der Nahrungskette und beeinträchtigt die Produktion keine wichtigen Ökosysteme wie den Regenwald. Dies wird von einem unabhängigen Nachhaltigkeitsrat überwacht.
Quelle und Grafik: Port of Rotterdam