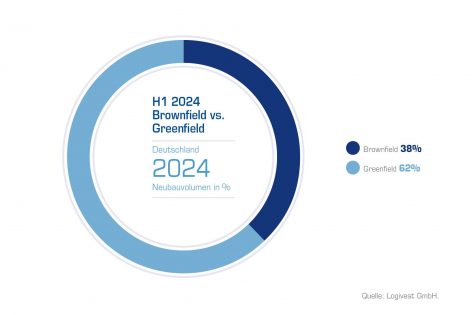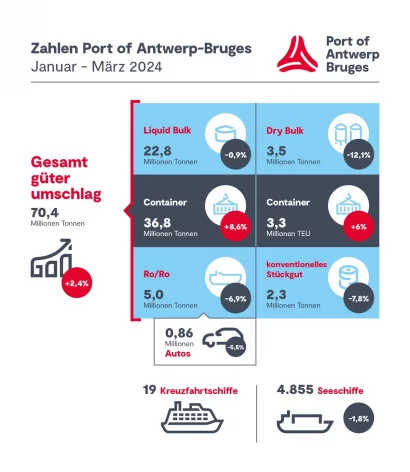Erster Spatenstich für den Neubau der Schleuse Kriegenbrunn

Mit einem gemeinsamen Spatenstich haben Vertreter des Bundes und der Region den Neubau der Schleuse Kriegenbrunn gestartet. Die Schleuse Kriegenbrunn am Main-Donau-Kanal ist eine der höchsten Schleusen in Deutschland. Der Neubau zählt zu den größten und komplexesten Investitionsprojekten des Bundes an den Wasserstraßen.
Hartmut Höppner, Staatssekretär im Bundesministerium für Digitales und Verkehr: „Die Wasserstraße ist ein wichtiger Teil unserer Verkehrsinfrastruktur und von besonderer Bedeutung für klimafreundliche Transport- und Logistikketten. Der Main Donau-Kanal verbindet 15 europäische Staaten und stellt somit einen wichtigen binneneuropäischen Handelsweg dar. Seine Leistungsfähigkeit beruht unter anderem auf den 16 Schleusen, die allesamt nicht mit Superlativen sparen. Die beiden Neubauten, die hier im laufenden Betrieb entstehen, sind ingenieurstechnische Meisterleistungen auf die alle Beteiligten stolz sein können.“
Die neue Schleuse wird bei laufendem Schiffsverkehr als Einkammerschleuse in Massivbauweise mit modernster Technik gebaut. Ebenso wie die bestehende Schleuse wird sie als sog. Sparschleuse mit drei seitlich angeordneten Becken gebaut, um bei der Überwindung der unterschiedlichen Wasserspiegel möglichst wenig Wasser zu verbrauchen. So kann der Wasserverbrauch bei den Schleusungen um bis zu 60 Prozent verringert werden. Durch den fugenlosen Bau und massive Kammerwände kann die neue Schleuse auch größten Lasten sicher und langlebig standhalten. Weiterer Vorteil ist, dass sie weniger wartungsintensiv sein wird, was sich kostenreduzierend auswirkt.
Nahezu parallel zum Neubau der Schleuse Kriegenbrunn wird auch die baugleiche Schleuse Erlangen neu gebaut. Das führt zu Synergien bei der Planung und beim Betrieb.
Dirk Schwardmann, Vizepräsident der Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt: „Durch den Neubau der Schleusen Kriegenbrunn und Erlangen investieren wir gezielt in die Zukunft. Wir sorgen für einen sicheren Transportweg und eine technisch und wirtschaftlich konkurrenzfähige Wasserstraße. Gleichzeitig fördern wir einen ökologischen und hochattraktiven Lebensraum.“
Der Main-Donau-Kanal bietet der Schifffahrt eine sichere Verbindung von der Nordsee – über Rhein, Main und Donau – bis zum Schwarzen Meer. Vom Bau der neuen Schleuse profitiert nicht nur die Schifffahrt, sondern auch die Region.
Dr. Florian Janik, Oberbürgermeister der Stadt Erlangen: „Der heutige Tag ist der offizielle Beginn eines riesigen Bauprojekts, das auch die Stadt Erlangen in den nächsten Jahren fordern wird. Zugleich ist diese Investition in unsere Infrastruktur ein bedeutendes Zeichen für die Zukunft und die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit unserer Region. Ich wünsche mir, dass die Modernisierung unserer Wasserwege mit dazu beiträgt, dass das Frachtvolumen auf dem Kanal weiter an Bedeutung gewinnen wird.“
Der Bauauftrag für das technisch hochkomplexe Bauwerk wurde in einem dialogbasierten Verhandlungsverfahren vergeben.
Mareike Bodsch, Leiterin des Wasserstraßen-Neubauamtes Aschaffenburg: „Wir sind der festen Überzeugung, dass auch auf der nun folgenden Baustelle, die partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen Bauindustrie und öffentlichem Auftraggeber, der Schlüssel für ein wirtschaftliches und effizientes Bauen sein wird.“
Der Main-Donau-Kanal hat darüber hinaus eine weitere Funktion. Er sorgt dafür, dass Wasser aus dem wassereichen Donaueinzugsgebiet in das wasserarme Regnitz-Main-Gebiet geleitet wird. In der vergangenen Hochwasserphase kam dem Main-Donau-Kanal eine wichtige Rolle bei der Ableitung von großen Wassermengen aus der Donau zu. Das Gebiet rund um den Kanal hat sich zu einem wichtigen Freizeit- und Naherholungsgebiet entwickelt und bietet zahlreiche Wassersportmöglichkeiten.
Die bestehende Schleuse Kriegenbrunn wurde im Rahmen des Baus des Main-Donau-Kanals in den Jahren 1966 bis 1970 konzipiert und realisiert.
Technische Daten Neubau Schleuse Kriegenbrunn:
- Gesamtlänge Schleusenbauwerk: 329 Meter
- Höhe Oberkante Planie bis Gründungssohle: 31,1 Meter
- Nutzlänge Kammer: 190,0 Meter
- Nutzbreite Kammer: 12,5 Meter
- Hubhöhe: 18,3 Meter
- Drei Sparbecken: Länge x Breite 178,7 x (3 x17,30) Meter
- Bauzeit: rund acht Jahre
- Auftragssumme: ca. 550 Mio. €
Quelle und Foto: Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes, WSV.de. Symbolischer Spatenstich zum Neubau der Schleuse Kriegenbrunn. Von links: Andreas Beier, WNA Aschaffenburg; Stephan von der Heyde, Züblin; Staatssekretär Hartmut Höppner, BMDV; Dr. Florian Janik OB Stadt Erlangen; Dirk Schwardmann, Vizepräsident GDWS; Mareike Bodsch, Leitern WNA Aschaffenburg; Florian Bauer, Bauer Spezialtiefbau