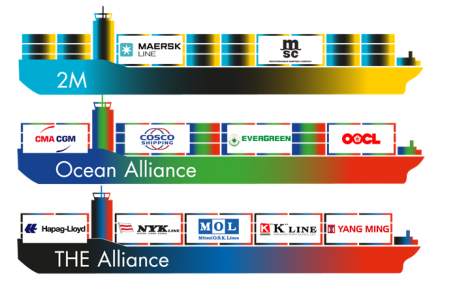Der Verband Verkehrswirtschaft und Logistik NRW (VVWL) begrüßt weitgehend den von der künftigen Landesregierung vorgestellten Entwurf des Koalitionsvertrages. Viele Forderungen der Logistik werden darin im Sinne des VVWL aufgeführt.
„Wir erhoffen uns von der neuen Landesregierung eine weitere Schärfung des Profils und Stärkung des Logistikstandortes NRW. Die Versprechen dazu sind im heute veröffentlichten Entwurf des Koalitionsvertrages enthalten, daran werden wir die Arbeit der künftigen Landesregierung messen“, betont Dr. Christoph Kösters, Hauptgeschäftsführer des VVWL NRW (Foto).
Wir freuen uns natürlich über das Bekenntnis zum Logistikstandort NRW und das Versprechen, alle Verkehrsträger und deren Schnittstellen auch für grenzüberschreitende Verkehre auszubauen und ausreichend Parkraum zu schaffen.
Besondere Bedeutung hat für uns, dass NRW zum Bundesland mit den schnellsten Planungs- und Genehmigungsverfahren werden soll. Die Leverkusener Autobahnbrücke, die seit 2013 für den Lkw-Verkehr gesperrt ist und deren Neubau physikalisch in 2017 trotz aller Priorisierung immer noch nicht begonnen hat, ist das Mahnmal dafür, wie dringend unser Planungsrecht modernisiert werden muss.
Ebenfalls aus Sicht der Logistik erfreulich: „Neubaumaßnahmen“ für Landesstraßen sind nicht mehr Tabu, sondern werden als Mittel zur Erschließung aufgeführt. Dass zur Finanzierung die Straßennutzer nicht noch stärker herangezogen werden sollen, entspricht 1:1 unseren in der Vergangenheit gestellten Forderungen.
Dass die neue Landesregierung pauschale Fahrverbote für Dieselfahrzeuge in Innenstädten ablehnt, ist im Sinne einer funktionierenden logistischen Versorgung und Entsorgung der Städte und Bürger sehr zu begrüßen. Der im Koalitionsvertrag angekündigte Schritt, Flottenfahrzeuge, die große Fahrleistungen im innerstädtischen Verkehr erbringen, schnell auf emissionsarme Antriebe umzustellen und den Anteil von Elektrobussen zu erhöhen, ist zwar grundsätzlich der richtige Weg, allerdings müssen in diesem Falle dringend Übergangsfristen eingeräumt werden. Die Verkehrswirtschaft muss sich bei der Investition in neue Fahrzeuge auf die bestehenden gesetzlichen Regelungen verlassen können. Es ist nicht vermittelbar, dass erst wenige Jahre alte Fahrzeuge plötzlich nicht mehr der Rechtslage entsprechen sollen. Der VVWL spricht sich hier zusammenfassend für intelligente Lösungen mit Übergangs- und Anpassungsfristen für den betroffenen allgemeinen Güter- und Wirtschaftsverkehr aus. Die gleichfalls gemachte Ankündigung, die wechselseitige gegenseitige Anerkennung der Handwerkerparkausweise zu ermöglichen, führt zu der Überlegung, hier auch das Umzugsgewerbe wieder mit in den Kreis der Antragsberechtigten einzuschließen.
Aus Sicht der Logistikbranche positiv zu werten sind die Ankündigungen, auch die LEP-Flächen für landesbedeutsame flächenintensive Großvorhaben zu ertüchtigen und weiterzuentwickeln und den newPark in den nächsten Jahren zum Top-Standort für neue Industrie in Nordrhein-Westfalen werden zu lassen. Auch der angekündigte Grundsatz, zum Erhalt der Wertschöpfungsketten sowie zur Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen in NRW seitens des Landes Standortsicherung und Standortentwicklung durch die Bereitstellung und Bevorratung von Flächen zur gewerblichen und industriellen Nutzung ermöglichen, signalisiert eine dringend notwendige ausgewogenere Flächenpolitik.
Der VVWL begrüßt, dass die neue Landesregierung beabsichtigt, die Potenziale der nordrhein-westfälischen Wasserstraßen besser zu nutzen. Zudem beabsichtigt die Landesregierung, die auch im Rahmen des 2016 vorgestellten Wasserstraßen-, Hafen- und Logistikkonzept getroffene Unterscheidung in landesbedeutsame und nicht landesbedeutsame Häfen (Binnenhäfen) aufzuheben, gleiches auch in Bezug auf die Flughäfen. VVWL und das von ihm mitgeführte Logistikcluster NRW hatten sich stets gegen eine solche Unterscheidung, insbesondere bei den Binnenhäfen, ausgesprochen.
Eine Stärkung, Weiterentwicklung und schnellstmögliche Umsetzung des Wasserstraßen-, Hafen- und Logistikkonzepts des Landes und die Entwicklung eines Landeshafengesetzes wird vom VVWL und der in ihm vertretenen maritimen Logistik gerne aktiv begleitet. Auf Basis des 2016 verabschiedeten Bundesverkehrswegeplans und der Verkehrswegeausbaugesetze begrüßt der VVWL zudem die Absicht, gegenüber dem Bund werden mit Nachdruck auf eine Sanierung der Schleusenbauwerke sowie auf die Anhebung der Fluss- und Kanalbrücken hinzuwirken und gemeinsam mit dem Bund und den anderen Rheinanliegerländern die Erhöhung der Abladetiefe des Rheins voranzutreiben. Überfällig ist es, analog zu dem Kooperationsabkommen mit dem Hafenstandort Hamburg ein Abkommen zur Zusammenarbeit zwischen Nordrhein-Westfalen und den ZARA-Häfen Zeebrügge, Antwerpen, Rotterdam und Amsterdam anzustreben und möglichst abzuschließen.
Schienenprojekte, die im Bundesverkehrswegeplan 2030 nur im sogenannten „Potentiellen Bedarf“ eingestuft sind, möglichst schnell in den „Vordringlichen Bedarf“ zu bringen, ist angesichts der bundesweit überragenden Bedeutung des Schienenverkehrsstandortes Nordrhein-Westfalen ein richtiger Weg. Dazu gehört neben dem im Koalitionsvertrag unter anderem genannten zweigleisigen Ausbau der Bahnstrecken Münster-Lünen und Kaldenkirchen-Dülken, dem dreigleisigen Ausbau der Strecke Aachen-Düren aber nicht zuletzt auch der Eiserne Rhein. Die Aussage, sich gemeinsam mit den Partnern Belgien und Niederlande für eine leistungsfähige, schienengebundene Anbindung des Antwerpener Hafens „stark zu machen“, bedarf an dieser Stelle einer näheren Konkretisierung. Die angekündigte Initiative gemeinsam mit dem Bund, anderen Rheinanliegerländern und der Deutschen Bahn zu einem Masterplan „Lärmbekämpfung und Bahnübergangsbeseitigung im Rheintal“ ist angesichts der Problemlage und der hochausgelasteten Nord-Süd-Magistralen zu begrüßen. Gleiches gilt im Grundsatz für das Vorhaben, zur Stärkung der nichtbundeseigenen öffentlichen Eisenbahnen (NE-Bahnen) die Infrastrukturförderung wieder einzuführen.
Nordrhein-Westfalen mit seiner stark außenhandelsorientierten Wirtschaft ist auch ein wichtiger Standort für Luftfrachtverkehre. Das Bekenntnis zur dezentralen Flughafeninfrastruktur in Nordrhein-Westfalen und zur Verbesserung der Anbindung der Flughäfen via Schiene und Straße ist zu würdigen. Bei den im Koalitionsvertrag angeführten Maßnahmen zum Thema Lärmschutz ist durch die neue Landesregierung dafür Sorge zu tragen, dass die Leistungsfähigkeit der Fracht-Drehkreuze und -Standorte, nicht zuletzt von Köln-Bonn und Düsseldorf, erhalten bleibt und nicht durch weiter einschränkende Regelungen behindert wird.
Den Vorrang des Bestands vor dem Neubau bei Verkehrsinfrastrukturen werden wir weiterentwickeln. Alle Verkehrsträger müssen nicht nur in einem guten Zustand erhalten, sondern je nach ihrem Bedarf auch ausgebaut werden können.
Das Vorhaben, Nordrhein-Westfalen zu einer „Modellregion für Mobilität 4.0 zu machen“ – mit intelligenter Verkehrsführung, neuen Mobilitätskonzepten und autonomem Fahren, aber auch mit konsequenter Beachtung des Datenschutzes wird begrüßt. Die nordrhein-westfälische Logistikwirtschaft tritt hierzu gerne in einen konzentrierten, anwendungs- und umsetzungsorientierten Austausch mit der Wissenschaft, innovativen Unternehmen und Entwicklern.
Wir hoffen, dass durch das Land NRW mehr Innovationsimpulse für das Verkehrssystem insgesamt und für den Güterverkehr im Besonderen gesetzt werden und die Digitalen Infrastrukturen in NRW flächendeckend und schnell im Sinne eines Standortvorteils im internationalen Standortwettbewerb ausgebaut werden. Der hohe Stellenwert, den der Digitale Ausbau im Entwurf des Koalitionsvertrages NRW erfährt, lässt uns dabei hoffen.
Mit Interesse hat der VVWL zur Kenntnis genommen, dass die neue Landesregierung den Mittelstand vor unfairer Konkurrenz durch öffentliche Unternehmen schützen und das Beteiligungsportfolio des Landes auf Privatisierungsmöglichkeiten hin prüfen will. Eine Betätigung von öffentlichen Unternehmen soll nur dann gerechtfertigt sein, wenn die Betätigung zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben dringend erforderlich ist und private Unternehmen diese Aufgabe nicht ebenso wirksam und effizient erledigen können. Erinnert sei hier an entsprechende Diskussionen und auch Beschwerden in Teilen der Logistikbranche (z.B. Entsorgungslogistik, Umzugsspedition und Hafenlogistik). Nach geltendem Landesrecht (§ 107 Gemeindeordnung NRW) gilt noch als Maßstab einer wirtschaftlichen Betätigung einer Gemeinde, dass der öffentliche Zweck durch andere Unternehmen nicht besser und wirtschaftlicher erfüllt werden kann. Hier müsste dann also auch folgerichtig die Gemeindeordnung geändert werden.
Über den VVWL: Der Verband Verkehrswirtschaft und Logistik Nordrhein-Westfalen (VVWL) e.V. ist der Wirtschafts- und Arbeitgeberverband der nordrhein-westfälischen Transport-, Speditions-, Logistik- und Entsorgungswirtschaft. Der VVWL ist Servicepartner und Interessenvertretung seiner Mitgliedsfirmen. Mit seinen rund 2.200 Mitgliedschaften ist er der führende Verband der nordrhein-westfälischen Verkehrs- und Logistikwirtschaft mit Geschäftsstellen in Düsseldorf und Münster.
Quelle und Foto: VVWL