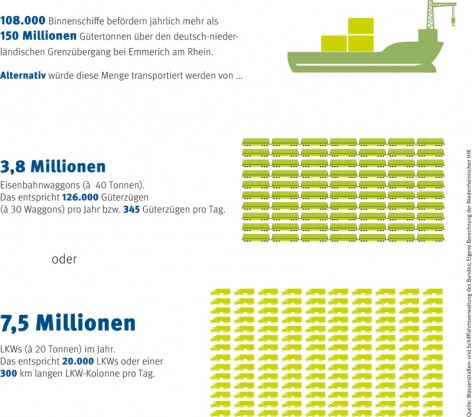Die Konjunkturtendenz der deutschen Logistikwirtschaft ist weiterhin aufwärts gerichtet. Das geht aus der jüngsten Erhebung (Februarbefragung) zum Logistik-Indikator hervor, den das Institut für Weltwirtschaft im Auftrag der Bundesvereinigung Logistik e.V. (BLV) ermittelt.
Der Klimawert stieg insgesamt zwar nur moderat um 1,7 Zähler, bestätigt damit aber die markante Aufhellung aus dem Vorquartal. Das Niveau von 138,2 markiert den höchsten Stand seit dem Herbst 2011. Die Lagebeurteilung hat auf hohem Niveau leicht um 3,7 Punkte nachgegeben, dies wurde aber durch anziehende Erwartungen (plus 7,1 Punkte) mehr als wettgemacht. Beide Marktseiten liegen nunmehr fast gleich auf, da die Anwender in Industrie und Handel mit einem Klimaanstieg um 3,8 Punkte zu den Anbietern (Logistikdienstleister) aufschließen konnten, deren Klimawert praktisch unverändert blieb. Hinsichtlich der kurzfristigen Geschäftstendenz ist eine große Mehrheit der Befragten zuversichtlich in dem Sinne, dass sie in den kommenden drei Monaten eine steigende Logistikaktivität erwarten. Auf beiden Marktseiten überwiegen die Zuversichtlichen um mehr als 40 Prozentpunkte diejenigen, die eine geringere Aktivität erwarten.
Beide Marktseiten liegen mit ihren Klimawerten etwa 10 Punkte oberhalb des 10-jährigen Indikatordurchschnitts, insofern stehen die Zeichen in der deutschen Logistikwirtschaft derzeit deutlich auf Expansion. Indikatoren zur Unternehmenszuversicht für die deutsche Wirtschaft insgesamt weisen seit der Jahresmitte auf eine deutlich verbesserte konjunkturelle Grundtendenz hin, und diese positive unternehmerische Stimmung überträgt sich demnach auch auf die Logistikwirtschaft.
Die weitere Klimaaufhellung der Logistikanwender in Industrie und Handel und ist im Wesentlichen auf eine günstigere Lageeinschätzung zurückzuführen (Anstieg um 7,2 Punkte). Die Lageverbesserung zeigt sich in einer leichten Verknappung der im Markt verfügbaren Logistikkapazität und ist begleitet von einer merklichen Verteuerung der Logistikkosten. Die Erwartungen für die nächsten 12 Monate blieben insgesamt fast unverändert, da eine nicht mehr ganz so starke Einschätzung der zukünftigen Logistikbedarfe im In- und Ausland von einer erhöhten Bereitschaft zum Ausbau der Sach- und Personalkapazitäten ausgeglichen wurde. Die Geschäftsentwicklung wird weiterhin äußerst positiv beurteilt. Der Klimawert für die Logistikdienstleister ist insgesamt kaum verändert, allerdings klaffen auf dieser Marktseite die Entwicklungen von Lage und Erwartungen auseinander. Nach einem furiosen Anstieg im Vorquartal um 25 Punkte gab die Lageeinschätzung zuletzt wieder um 14,6 Punkte nach, während die Erwartungskomponente die Verschlechterung vom Vorquartal (minus 12 Punkte) nun mit einem Anstieg um 13 Punkte egalisierte. Zu der verschlechterten Lageeinschätzung haben eine geringere Kapazitätsauslastung und eine leicht verschlechterte, aber weiterhin als gut beurteilte Auftragslage beigetragen. Auch die Entwicklung der binnenwirtschaftlichen und grenzüberschreitenden Auftragseingänge wurde weiterhin positiv beurteilt, sie verlor gegenüber dem Vorquartal aber leicht an Dynamik. Das Vertrauen in eine weiterhin positive Entwicklung mit Blick auf die kommenden 12 Monate hat sich hingegen wieder gefestigt. Nicht nur konnten die Aussichten auf die Geschäfts- und Auftragsentwicklung ihre Vorquartalswerte merklich übertreffen, sondern auch die Bereitschaft zur Ausweitung der Sach- und Personalkapazitäten hat deutlich angezogen.
Sonderthema: Digitalisierung und Innovationsmanagement
Impulse zu neuen digitalen Geschäftsmodellen in der Logistikwirtschaft kommen vor allem aus der Führung der Logistikunternehmen oder werden seitens der Kunden angestoßen. So geben gut 60 Prozent der Befragten an, dass die Unternehmensleitung die Entwicklungsziele vorgibt (top-down), weniger verbreitet – vor allem bei den Logistikdienstleistern – ist der umgekehrte Weg, wo Impulse von Mitarbeitern kommen und bereitwillig vom Management aufgenommen werden (bottom-up). Rund die Hälfte der Unternehmen reagiert mit digitalen Innovationen auf neue Kundenanforderungen, und bei 40 Prozent der Unternehmen werden Mitarbeiter ermutigt, ungewohnte Wege zu gehen und werden dabei mit Zeit und Geld unterstützt. Gut ein Viertel der Unternehmen lässt sich von Digitalisierungs-Experten beraten („Digital natives“).
Im Innovationsmanagement stellen sich die Logistiker mehrheitlich als fehlertolerante und lernfähige Organisationen auf. Für mehr als die Hälfte der Befragten gehören Fehler zum Innovationsprozess dazu, aus denen gelernt werden kann – übereinstimmend äußert sich fast kein Unternehmen so, als ob man sich Fehler generell nicht leisten könne. In rund 70 Prozent der befragen Unternehmen werden kalkulierte Risiken im Innovationsprozess durch interdisziplinäre Teams und geeignete Maßnahmen des Controllings flankiert. Etwa 40 Prozent beziehen auch ihre Kunden im Sinne von „Open Innovation“ in die Prozesse ein. Dagegen wartet lediglich ein sehr geringer Anteil der Befragten zunächst die Entwicklung in anderen Unternehmen ab, um eigene Fehlschläge im Innovationsprozess zu vermeiden.
Technische Anmerkung: Im laufenden Quartal wurde für die Indikatorberechnung eine Verfahrenskorrektur vorgenommen, durch die sich die saisonbereinigte Lageeinschätzung der Logistikdienstleister leicht von den zuletzt gemeldeten Niveaus unterscheidet. Das Konjunkturklimabild ändert sich hierdurch indes nicht.
Der Logistik-Indikator wird vom Institut für Weltwirtschaft (IfW) an der Universität Kiel für die Bundesvereinigung Logistik e.V. (BVL) berechnet. Konstruktionsgemäß kann der Indikator Werte zwischen 0 und 200 annehmen, wobei ein Wert von 100 eine konjunkturelle Normalsituation kennzeichnen soll (befriedigende und stabile Geschäfts- und Auftragslage mit normaler Kapazitätsauslastung). Über die Erhebungshistorie des BVL-Logistikindikators (10 Jahre) wurden bislang indes durchschnittliche Indikatorwerte von etwa 127 Punkten erreicht, was eine zusätzliche Orientierung zur Bestimmung einer Normalsituation der Logistikkonjunktur bietet. Das dem Indikatorkonzept zugrunde liegende Fragedesign zielt bei quartalsbezogenen Angaben auf eine Einschätzung der jahreszeitlich üblichen (um saisonale Effekte bereinigten) Werte ab. Gleichwohl schlagen sich im Antwortverhalten Saisoneffekte nieder, die mit einem statistischen Standardverfahren zur Saisonbereinigung (Census-X12-ARIMA) aus den Indikatorwerten herausgerechnet werden.
Kommentar von Prof. Dr.-Ing. Raimund Klinkner, Vorsitzender des Vorstands, Bundesvereinigung Logistik (BVL): „Es war schon beim BVL-/VDA-Forum Automobillogistik Mitte Februar im Mercedes-Benz-Werk in Bremen zu spüren: Die Stimmung unter den Logistikern aus Industrie, Handel und Dienstleistung ist im ersten Quartal 2017 von Gelassenheit und Optimismus geprägt. Nicht geopolitische Ereignisse dominieren die Diskussionen, sondern Strategie und Praxis – und hier vor allem die Chancen und Risiken des Digitalisierungsprozesses, der alle Handlungsfelder von Supply Chain Management und Logistik erfasst hat.
Das Bundeswirtschaftsministerium berichtet zudem, die deutsche Wirtschaft sei 2016 preisbereinigt um 1,9 Prozent gewachsen. Die Arbeitslosigkeit befinde sich auf dem niedrigsten Stand seit 25 Jahren und Deutschland verzeichne mit mehr als 43,5 Millionen Erwerbstätigen erneut einen Beschäftigungsrekord. Die realen Nettolöhne und -gehälter seien seit 2013 durchschnittlich um mehr als 1,4 Prozent pro Jahr gestiegen. Die anhaltende binnenwirtschaftliche Dynamik durch Konsumausgaben und Wohnungsbauinvestitionen zeigt Wirkung. So legt auch der Klimawert des Logistik-Indikators verglichen mit dem Vorquartal nochmals zu – auf den höchsten Stand seit Herbst 2011.
Beide Marktseiten liegen mit ihren Klimawerten um rund zehn Punkte über dem Indikatordurchschnitt der letzten zehn Jahre. Die langfristigen Erwartungswerte werden von allen Marktbeteiligten mindestens auf stabilem Niveau oder höher angegeben – ein Indiz für eine robuste Gesamtsituation. In der Dreimonatsperspektive wird mehrheitlich eine Nettoverbesserung des Logistikgeschäfts erwartet – mehr Euphorie geht nicht.
Mit der Zusatzfrage zum Indikator wurde herausgearbeitet, dass in der Praxis die Entwicklung neuer digitaler Geschäftsmodelle in Industrie, Handel und Dienstleistung in mehr als 60 Prozent der Betriebe durch die Leitungsebene vorangetrieben werden. Rund die Hälfte der Unternehmen geben an, dass sie von ihren Kunden deutliche Signale erhalten, dass innovative Lösungen gewünscht sind. Im Innovationsprozess werden von der Mehrheit der Unternehmen kalkulierbare Risiken eingegangen und Fehler als kreativer Teil des Innovationsprozesses akzeptiert. Den Satz „Wir können uns Fehler – auch in diesem Prozess – nicht leisten“ unterschreiben weniger als fünf Prozent der Befragten.
Zusammen mit den Erkenntnissen der Studie „Trends und Strategien in Logistik und Supply Chain Management“, die die BVL Anfang März veröffentlicht hat, sind diese Ergebnisse ein gutes Signal für die Bewältigung der Herausforderungen der Digitalisierung. Strategisch, taktisch und operativ, bei Sachinvestitionen und bei der Qualifizierung der Mitarbeiter/innen wird die Digitale Transformation das Jahr 2017 dominieren. Die BVL trägt dem mit ihrer inhaltlichen Arbeit Rechnung und hat das Jahr und den 34. Deutschen Logistik-Kongress im Oktober unter das Motto gestellt: „Neues denken, Digitales leben“. Die gute Konjunktur wird helfen, zielführende neue Wege ohne Zögern zu wagen.“
Quellen: BVL und iwf, Foto: NDH