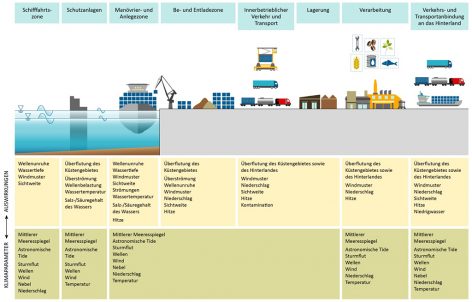Antwerpen ortet Treibgut per Drohne
Treibgut gehört nicht in den Hafen von Antwerpen. Um es so schnell wie möglich aufzuspüren und zu beseitigen, wird Port of Antwerp Drohnen einsetzen. Dies ist nur eine der innovativen digitalen Lösungen, die den Hafen zukunftssicher machen sollen. Bei ihrem heutigen Besuch im Hafen konnte sich Ministerin Petra De Sutter mit eigenen Augen davon überzeugen, wie diese Art von Lösungen zu einem sauberen und sicheren Hafen beitragen.
Jedes Jahr werden etwa 50 Tonnen Treibgut in den Docks im Hafen von Antwerpen gesammelt. Dieser Abfall besteht unter anderem aus Kunststoffen, Holz, Pappe, organischem Material und Leinen. Um die Wasserverschmutzung, die Auswirkungen auf die biologische Vielfalt und die Schäden an Schiffen zu verringern, ist es wichtig, diese Abfälle so schnell wie möglich zu erkennen und zu beseitigen. Da das gesamte Hafengebiet jedoch mehr als 120 km² umfasst, sind viele Augen nötig, um dieses gigantische Gebiet zu überwachen. Dank ihrer einzigartigen Perspektive aus der Luft können Drohnen einen wichtigen Beitrag zur Erkennung dieses Treibguts leisten. Aus diesem Grund hat Port of Antwerp eine Bildverarbeitungsanwendung entwickelt, die auf der Grundlage von Drohnenbildern automatisch eine Karte erstellt, die zeigt, wo sich Treibgut befindet. Mit dem Einsatz von Drohnen, die bald mehrmals täglich den gesamten Hafen überfliegen werden, kann Treibgut schneller und effizienter geortet und gereinigt werden.
Nach Angaben von Port of Antwerp wird der Einsatz von Drohnen im Hafen der Zukunft eine zunehmend wichtigere Rolle spielen. Angestrebt wird ein Netz autonomer Drohnen, die eine „Live-Übertragung“ der verschiedenen Hafenaktivitäten liefern und den Harbour Safety & Security (HSS)-Dienst und seine Sicherheitspartner so weit wie möglich unterstützen können. Dazu gehören Aufgaben wie die Inspektion der Infrastruktur, die Überwachung und Kontrolle, das Management von Zwischenfällen, das Management von Liegeplätzen und das Aufspüren von Ölverschmutzungen oder Treibmüll. Um die Bilder der Drohnen in Echtzeit übertragen zu können, wird in Zukunft 5G eingesetzt. Dies geschieht bereits beim Vorfallmanagement, wie etwa einem Brand im Hafengebiet im vergangenen Jahr, bei dem die Feuerwehr durch einen Live-Stream von Drohnenbildern über das 5G-Netz unterstützt wurde. Dank einer Kombination aus Farb- und Infrarotbildern konnte sich die Feuerwehr ein besseres Bild von der Lage der Brände machen.
Piet Opstaele, Manager Innovation Enablement Port of Antwerp, empfing jetzt Petra De Sutter, Vizepremierministerin und Ministerin des Öffentlichen Dienstes, der Öffentlichen Unternehmen, der Telekommunikation und der Post, im Nautischen Operationszentrum (NOC) des Hafens und erläuterte den Einsatz von Drohnen und einige andere innovative digitale Anwendungen im Hafen, wie die Echodrone, ein autonomes Peilboot mit einzigartiger Technologie.
Ministerin der Telekommunikation Petra De Sutter: „Ich erfahre hier im Hafen von Antwerpen einen Blick in die Zukunft. Drohnen, die den Hafen sauber und sicher halten. Es ist ein gutes Beispiel dafür, wie Digitalisierung, eine saubere Umwelt und der Kampf gegen den Klimawandel Hand in Hand gehen können. Ich freue mich sehr auf den weiteren Mehrwert, den 5G im Hinblick auf ökologische Anwendungen bieten kann. Mit Hilfe von 5G kann eine Drohne problemlos sehr große Datenmengen übertragen. Das ist nicht nur gut für die Umwelt. Auch zur Sicherheit. Der Hafen liegt in der Nähe der Stadt. Wenn es brennt, können die Wärmebildkameras der Feuerwehr sofort helfen.“
Piet Opstaele: «Ein sauberer und sicherer Hafen ist eine wichtige Priorität für Port of Antwerp. Der Einsatz von Drohnen zur Erkennung von Treibgut ist ein gutes Beispiel dafür, wie Innovation und Digitalisierung dazu beitragen können. Heute konnten wir der Ministerin zeigen, wie innovative Lösungen den Hafen zukunftssicher machen werden.“
Annick De Ridder, Hafendezernentin: “Der Hafen von Antwerpen ist der Motor unserer Wirtschaft. Wir müssen diesen Motor so sauber, sicher und reibungslos wie möglich laufen lassen. Ab 2023 werden wir mit Hilfe von Drohnen in der Lage sein, systematisch, intelligent und effizient Treibgut im riesigen Hafengebiet zu finden. Dank Innovation und Digitalisierung können wir so zum Beispiel die Wasserverschmutzung, die Auswirkungen auf die biologische Vielfalt und die Schäden an Schiffen minimieren.“
Quelle und Video: Port of Antwerp