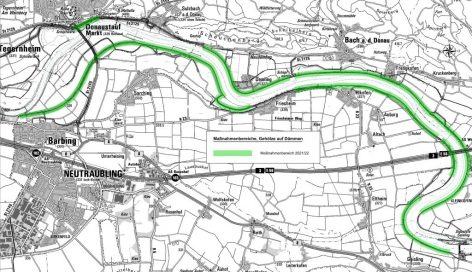Nach 17 Monaten intensiver Arbeit mit einem breiten Kreis von Akteuren hat die Deutsche Energie-Agentur (dena) den Abschlussbericht der dena-Leitstudie Aufbruch Klimaneutralität veröffentlicht. Zehn wissenschaftliche Institute haben dazu ihre Expertise eingebracht und mehr als 70 Unternehmen ihre Branchenerfahrungen und Markteinschätzungen gegeben, ebenso ein 45-köpfiger Beirat mit hochrangigen Expertinnen und Experten aus Wissenschaft, Politik und Gesellschaft.
Sie haben gemeinsam untersucht, welche Technologiepfade aus heutiger Perspektive realistisch sind und welche Rahmenbedingungen es braucht, um diese bis 2045 in einem integrierten klimaneutralen Energiesystem in Deutschland zu realisieren. Dabei wurden konkrete Lösungssätze und CO2-Reduktionspfade für einzelne Sektoren (Bau, Verkehr, Industrie, Energieerzeugung sowie zu LULUCF) analysiert und identifiziert.
„Die dena-Leitstudie liefert der zukünftigen Bundesregierung eine praxisorientierte Perspektive zur Erreichung von Klimaneutralität bis 2045. In Ergänzung zu einer umfassenden und ausdifferenzierten Analyse wurden insgesamt 84 Aufgaben in zehn zentralen Handlungsfeldern identifiziert, die eines gemeinsam haben: Jede einzelne Aufgabe ist machbar. Die erforderliche parallele Orchestrierung aller dieser Aufgaben aber ist eine gewaltige Herausforderung. Deutschland muss neuen Schwung holen in der Energie- und Klimapolitik. Es gilt eine neue Veränderungsdynamik anzustoßen. ‘Weiter so‘ ist keine Option! Energiewende und Klimapolitik müssen besser organisiert, das historische Klein-Klein der vergangenen Jahre überwunden werden. Es bedarf einer grundlegenden Veränderung der Herangehensweise an diese Jahrhundertaufgabe. Gelingt uns dieser ‘Aufbruch Klimaneutralität‘, werden wir in der Lage sein, die gesetzlich verankerten Ziele für 2030 zu erreichen. Auch Klimaneutralität im Jahr 2045 kann dann eine erreichbare Perspektive sein“, erklärte Andreas Kuhlmann, Vorsitzender der Geschäftsführung der dena. „Die konkreten sektorspezifischen Jahresziele für die unmittelbar vor uns liegenden Jahre werden allerdings mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht erreicht. Zuviel ist liegen geblieben in den vergangenen Jahren. Dessen sollte sich die neue Bundesregierung unbedingt bewusst sein. Die gegenwärtigen gesetzlichen Regelungen stehen einem zielorientierten effizienten Handeln entgegen und verhindern so die notwendige Dynamik“, so Kuhlmann weiter.
Die dena-Leitstudie zeigt anhand eines zentralen Szenarios (Szenario Klimaneutralität 100, KN100) wie die Sektorziele im Jahr 2030 und Klimaneutralität im Jahr 2045 erreicht werden können – welche Energieträger und Technologien in welchen Mengen benötigt werden sowie die dafür notwendigen transformatorischen Veränderungen. Die Studie setzt sich an verschiedenen Stellen mit Zielkonflikten und umzukehrenden Trends auseinander. Sie beschreibt in Exkursen zu Einzelthemen die Rolle, welche die verschiedenen Akteure übernehmen müssen. In vier Pfadausprägungen untersucht die Studie zudem Varianten zur Zielerreichung, etwa einen höheren Anteil von direkt-elektrischer Nutzung gegenüber einem höheren Anteil von gasförmigen oder flüssigen Energieträgern oder die Auswirkungen von verstärkten gegenüber begrenzten Anstrengungen zur Erhöhung der Energieeffizienz.
Um Klimaneutralität zu erreichen, ist aus technologischer Betrachtung eine Vier-Säulen-Strategieerforderlich: Die Erhöhung der Energieeffizienz ist eine wesentliche Maßnahme in allen Verbrauchssektoren, insbesondere in der Industrie und im Gebäudesektor. Für den umfassenden direkten Einsatz von erneuerbaren Energien ist in vielen Anwendungsbereichen neben der Energieeffizienzverbesserung eine breite und deutlich beschleunigte Elektrifizierung eine Grundvoraussetzung. Neben Strom werden erneuerbare gasförmige und flüssige Energieträger und Rohstoffe benötigt. Als vierte Säule braucht es technische und natürliche CO2-Senken. „Wir werden nicht alle Emissionen vermeiden können, insbesondere in der Landwirtschaft und der Industrie. Daher muss die zukünftige Bundesregierung schnell eine Strategie für den Ausbau vorhandener und die Erschließung neuer natürlicher und technischer Senken entwickeln“, so Kuhlmann. „Diese vier Säulen haben unterschiedliche zeitliche Perspektiven. Ihnen allen ist gemein, dass sie erhebliche Anstrengungen in den Aufbau entsprechender Infrastrukturen bedürfen. Das gilt für Strom, Gas, Wasserstoff, Wärmenetze und CO2 in gleicher Weise wie für die Verkehrsinfrastruktur, die Digitalisierung und die administrative Infrastruktur, gegenwärtig eine der Hauptblockaden für das Aufnehmen neuer Dynamik“, erklärte Kuhlmann.
Die Energieversorgung ist aktuell der größte CO2-Emittent. Reduktionen müssen hier am stärksten und am schnellsten erfolgen, so die Studie (von 308 Mio. Tonnen CO2ä in 2018 auf 104 Mio. t CO2ä in 2030 und auf -8 Mio. t CO2ä in 2045). Zentral ist dabei, dass sich die erneuerbaren Stromkapazitäten bereits bis 2030 mehr als verdoppeln müssen. Die installierte Leistung von Solarenergie zum Beispiel steigt von 45 Gigawatt (GW) auf 131 GW, Windenergie an Land von 52 GW auf 92 GW. Die Kohleerzeugung wird 2030 marktgetrieben kaum noch eine Rolle spielen, die Nutzung von Erdgas in der Stromerzeugung nimmt dagegen bis 2030 zu. Bereits dieser ‚Fuel Switch‘ trägt bis 2030 erheblich zur Emissionsminderung in der Energiewirtschaft bei. Wasserstoff und Powerfuels werden bis 2030 nur eine geringe Rolle spielen. Der Aufbau entsprechender Infrastruktur und Märkte ist aber unabdingbar, denn die Rückverstromung von grünem Wasserstoff wird 2045 nach Windkraft und Photovoltaik zur drittwichtigsten Stromerzeugungsquelle. Bis 2035 spielt blauer Wasserstoff eine, wenn auch geringe Rolle, danach geht er gemäß Modellierung der dena-Leitstudie sukzessive aus dem Markt.
„Um Klimaneutralität in der Energieversorgung zu erreichen, braucht es den beschleunigten, marktbasierten Ausbau der erneuerbaren Energien durch eine Vereinheitlichung und Vereinfachung von Genehmigungsverfahren und die Bereitstellung von mehr Flächen. Parallel müssen bis 2030 leistungsfähige Märkte und Infrastrukturen für Powerfuels entstehen. Wichtig ist vor allem eine aktive Begleitung des vorzeitigen Ausstiegs aus der Kohleverstromung. Dabei gilt es eine Reihe von technologischen Anforderungen zu beachten, die in einem gesonderten Exkurs im Detail in der Studie dargelegt werden. Dazu gehört auch: Versorgungssicherheit in der Transformation erfordert ein neues Konzept mit dem Zubau von gesicherter Leistung und Anreizen für Flexibilitäten. Ohne einen entsprechenden Mechanismus für die Sicherung neuer Kapazitäten wird das nicht möglich sein. Auch auf den Ausbau der Stromnetze und die Wärmeversorgung kommen dabei immense Herausforderungen hinzu, die eine Reihe von absichernden Mechanismen erforderlich machen“, so Kuhlmann.
Die Industrie folgt an zweiter Stelle der höchsten Emissionen. Hier muss der Ausstoß allein bis 2030 um rund 36 Prozent sinken. Nach einer relativen Stagnation in den vergangenen zwei Jahrzehnten bedarf es zur Erreichung der Minderungsziele im laufenden Jahrzehnt einer durchschnittlichen Absenkung von ca. 8 Mio. t CO2 pro Jahr. Fast 70 Prozent des Minderungsbeitrags entfallen auf die energetischen Emissionen. Die stärksten Veränderungen werden bis 2030 auf die Branchen Stahl und Chemie zukommen. „Um Klimaneutralität in der Industrie zu erreichen, braucht es eine transparente Treibhausgasbilanz in der gesamten Wertschöpfungskette, konsequente Kreislaufwirtschaft, finanzielle Lenkungswirkung über die CO2-Bepreisung, die Schaffung neuer Leitmärkte sowie den schnellen Hochlauf von emissionsarmen Technologien und Produktionsverfahren. Auch der Umbau der Abgaben und Umlagen – insbesondere das unmittelbare Absinken der EEG-Umlage auf null – sind wesentliche Grundlagen für die Aussicht auf Erfolg“, so Kuhlmann weiter. Die Industrie ist bis 2045 und bleibt auch langfristig der größte Abnehmer von Wasserstoff zur energetischen und stofflichen Nutzung. Hierfür müssen die notwendigen Voraussetzungen zur Umstellung der Prozesstechnologien sowie zum Aufbau der Infrastrukturen getroffen werden.
Der Verkehrssektor steht aktuell an dritter Stelle der Emissionen und hat die größte Reduktionsaufgabe aller untersuchten Verbrauchssektoren: Schon bis 2030 muss der Ausstoß um rund 48 Prozent sinken (von rund 164 auf 85 Mio. t CO2ä). Die stärkste Minderung muss im Individualverkehr erfolgen, gefolgt vom Lkw-Verkehr. Dabei wird im Personenverkehr ein Hochlauf der Elektromobilität auf 9,1 Millionen vollelektrische Fahrzeuge (bzw. 14 Mio. Fahrzeuge inklusive Hybride) bis 2030 als notwendig erachtet. Wasserstoff wird kaum eine Rolle spielen. „Um Klimaneutralität im Verkehrssektor zu erreichen, braucht es eine Forcierung der Elektromobilität im Individualverkehr, umfassenden Einsatz von Wasserstoff und Powerfuels im Schwerlastverkehr, den intensivierten Ausbau des ÖPNV und eine bessere Verknüpfung mit anderen Mobilitätsangeboten sowie größere planerische Gestaltungsfreiheit für Kommunen. Wichtig ist auch: Förderinstrumente, die im Wesentlichen auf die Zementierung der Individualmobilität ausgerichtet sind, stehen den erforderlichen transformatorischen Veränderungen im Verkehrsbereich eher im Weg“, erklärte Kuhlmann die Herausforderungen im Verkehrssektor.
Auch im Gebäudebereich müssen die CO2-Emissionen allein bis 2030 um 44 Prozent sinken (von rund 120 auf rund 67 Mio. t CO2ä). Der Großteil der Minderungen (46,5 Mio. t CO2ä) entfällt auf Maßnahmen an der Gebäudehülle und technische Anlagen. Der Einsatz von Wärmepumpen, der Ausbau der Anschlüsse an Wärmenetze muss massiv vorangetrieben werden. Im Szenario KN100 werden für das Jahr 2030 bereits 4,1 Millionen Gebäude mit Wärmepumpen versorgt, im Jahr 2045 sieht die Studie 9 Millionen Wärmepumpen. In 2030 werden 1,3 Millionen weitere Wohnungen (gegenüber 2019) durch Wärmenetze versorgt werden, 2045 sind es dann 2,7 Millionen. Auch der Einsatz von klimaneutralen Brennstoffen muss sich schon bis 2030 mehr als verdreifachen, von heute 9 auf dann 32 Terawattstunden (TWh). Bis 2045 erfolgt eine weitere Vervierfachung auf 120 TWh. Aufgrund der Vielschichtigkeit des Gebäudesektors mit seinen sehr spezifischen Herausforderungen ist aus heutiger Perspektive ein klimaneutraler Gebäudebestand ohne Wasserstoff und klimaneutrale Gase nicht denkbar. Eine besondere Herausforderung ist der dafür erforderliche Umbau der Infrastruktur. „Um Klimaneutralität im Gebäudebestand zu erreichen, braucht es tiefgreifende Veränderungen mit hoher Geschwindigkeit. Gebäude mit dem schlechtesten Standard müssen zuerst angepackt, Sanierungsverfahren standardisiert, massiv intensiviert und die Wärmeversorgung schnell dekarbonisiert werden“, so Kuhlmann.
„Es reicht aber nicht aus, Transformationspfade in einem Handlungsfeld oder einem Sektor zu beschreiten, es braucht die Verknüpfung von Maßnahmen in verschiedenen Handlungsfeldclustern“, so Kuhlmann weiter. Die dena-Leitstudie zeigt die Notwendigkeit eines zielführenden Energiemarktdesigns, das die Transformation beschleunigt und möglichst effektiv Investitionen in klimaneutrale Technologien und Infrastrukturen auslöst. Dabei spielt ein CO2-Preis mit mehr Lenkungswirkung, die Angleichung staatlich induzierter Preisbestandteile und der Aufbau einer integrierten Infrastrukturplanung eine zentrale Rolle. „Grundlage des Gelingens wird sein, die unterschiedlichen Technologiepfade offen zu halten und keine frühzeitigen Vorfestlegungen zu treffen, die Optionen zur Erreichung der Klimaziele unnötigerweise einschränken. Alle Optionen, innovative Technologien zu identifizieren, zu unterstützen und zu skalieren müssen massiv vorangetrieben werden. Aber auch durch die Nachfrageseite sollten Innovationen zur Erreichung von Klimaneutralität gestärkt werden, beispielsweise durch eine auf klimaneutralen und innovativen Technologien beruhende Beschaffung der öffentlichen Hand. Die Steigerung von Forschung und Entwicklung sind ebenso notwendig“, so Kuhlmann.
Große Bedeutung für die Erreichung der Klimaneutralität hat die europäische Ebene, denn sie setzt maßgebliche übergeordnete rechtliche Rahmenbedingungen. „Die Studie verdeutlicht, dass die Energiewende stärker europäisch und international gedacht werden muss. Deutschland sollte bei der Umsetzung des ‚Fit for 55‘-Pakets zum Vorreiter werden die nationale Energiepolitik den europäischen ‚Green Deal‘ als Leitbild nehmen. Entsprechende Initiativen wie der ‚Klimaclub‘ sollten weiter forciert, die europäische integrierte Infrastrukturentwicklung vorangetrieben und die internationalen Energiepartnerschaften insbesondere im Bereich Wasserstoff ausgeweitet werden“, so Kuhlmann. „Allein die radikale Veränderung der Importe von Energie und ein Blick auf die damit verbundenen geopolitischen Herausforderungen unserer Partnerländer macht deutlich, dass Klimapolitik eine zentrale Aufgabe für den oder die nächsten Außenminister/in sein muss.“
Der gewaltige Transformationsprozess funktioniert aber nur mit den Bürgerinnen und Bürgern zusammen und muss sozial gerecht ausgestaltet sein. „Partizipieren und profitieren Bürgerinnen und Bürger an und von der Energiewende, steigt die Akzeptanz für die Transformation. Die Förderung von ‚Energy Communities‘ spielt dabei eine zentrale Rolle. Gesellschaftliche Verhaltens- und Konsummuster sind so leichter zu verändern. Auch die Rolle der Bürgerinnen und Bürger als Prosumer sollte gestärkt werden“, ist Kuhlmann überzeugt. Maßnahmen wie die verbindliche Beteiligung der Kommunen an Einnahmen von Erneuerbare-Energien-Projekten oder die Abschaffung klimaschädlicher Subventionen können die Akzeptanz fördern und Ansätze wie eine Pro-Kopf-Energie-Geld die soziale Ausgestaltung der Energiewende verbessern. „Neben einer effektiven Energie- und Klimapolitik ist ein konsistentes Politikkonzept erforderlich, welches die unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen befähigt, die transformatorischen Veränderungen mitzugestalten, soziale Verwerfungen vermeidet und die wirtschaftlichen Chancen der Energiewende nutzt.“
„Jede einzelne der Aufgaben dieses gewaltigen Transformationsprozesses ist gestaltbar. Ob uns die gleichzeitige Orchestrierung all dieser Aufgaben gelingt, werden die nächsten Jahre zeigen. Ganz zweifelsohne sind die 2020er Jahre ein Jahrzehnt von ganz besonderer Bedeutung für den Aufbruch und Fortschritt in diesem Land. Dabei kann die dena-Leitstudie eine gute Grundlage für die Regierungsarbeit der kommenden Jahre sein“, so Kuhlmann abschließend.
Die dena-Leitstudie Aufbruch Klimaneutralität verfolgt – wie die erste dena-Leitstudie aus dem Jahr 2018 – systemisch einen integrierten Ansatz. Neu an der dena-Leitstudie Aufbruch Klimaneutralität ist die Einbindung von Querschnittsthemen. Um integrierte Lösungen zu erarbeiten, diskutierten die projektbeteiligten Expertinnen und Experten in drei gemeinsamenQuerschnittsmodulen zusätzlich sektorübergreifende Inhalte: Energiemarktdesign, Transformation sowie Wirtschaft & Europa.
Analog zur ersten dena-Leitstudie fand ein wesentlicher Teil der Analysen in vier Sektormodulen statt: Sie betrachten die Entwicklung für die Energiewirtschaft sowie für Gebäude, Industrie und Verkehr. Arbeitsschwerpunkte waren die Diskussion konkreter Optionen zur Erreichung von Klimaneutralität im Jahr 2045 sowie die passende Parametersetzung zur Quantifizierung der sektorspezifischen Transformationspfade im Rahmen der energiesystemischen Modellierung.
Quelle und Foto: Deutsche Energie-Agentur