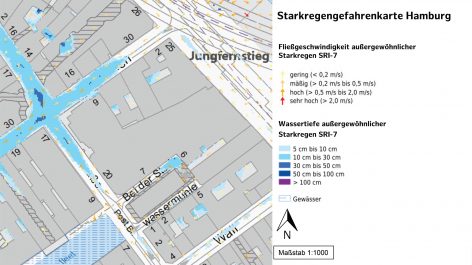viadonau veröffentlicht Jahresbericht Donauschifffahrt 2023

DIE jährliche Publikation für klare Sicht auf der Donau ist ab sofort digital verfügbar! Geht es um die Entwicklung der Wasserstraße Donau steht der viadonau-Jahresbericht zur Donauschifffahrt in Österreich seit vielen Jahren mit konkreten Zahlen zum Beispiel zu den Fahrwassertiefen, der Schleusenverfügbarkeit oder auch zum Güter- und Passagierverkehr Rede und Antwort. Die Daten und Fakten zum Jahr 2023 offenbaren: moderate Rückgänge im Gütertransportaufkommen, weiter wachsende Personenschifffahrt, hohe Verfügbarkeit der Wasserstraße und wichtige infrastrukturelle Modernisierungserfolge.
Apropos, ebenso wie der Entwicklungsansatz von viadonau sind auch die Projektmeilensteine zur nachhaltigen Modernisierung der Wasserstraße vielfältig, die Highlights des Jahres 2023: das neue, gemeinsam mit dem Klimaschutzministerium ausgearbeitete Aktionsprogramm Donau, die Inbetriebnahme erster Landstrom-Terminals an aufgewerteten Liegestellen für die Güterschifffahrt in Linz und Wildungsmauer sowie auch der Startschuss von FAIRway Danube II, das als internationales Modernisierungs-Großprojekt starke Akzente in Sachen Kennzeichnung der Wasserstraße, Upgrade von Pegelmessstellen und Aufwertung der Vermessungsflotten setzt.
Während die Donau sowohl national als auch international klar auf Zukunftskurs ist, zeigt sich die Entwicklung des Schiffsverkehrs 2023 weiterhin durchwachsen. So stehen einem erneuten Rückgang des Gütertransportaufkommens um rund 5 Prozent auf sechs Millionen Tonnen eine – mit einem Zuwachs von rund 25 Prozent – weiter erstarkende Personenschifffahrt gegenüber. Ein nur leichter Rückgang der geschleusten Schiffseinheiten im Jahr 2023 sowie die mit 361 Tagen des Jahres hohe Verfügbarkeit der Wasserstraße bestätigen jedoch einmal mehr die Rolle des Stroms als verlässlichen Verkehrsträger sowie die Bedeutung proaktiven und treffsicheren Wasserstraßenmanagements Marke viadonau.
Mehr Daten und Fakten können ab sofort im viadonau-Jahresbericht zur Donauschifffahrt in Österreich 2023 nachgelesen werden.
eine Übersicht mit den wichtigsten Zahlen bietet eine digitale Entdeckungstour
Hier geht es zur Publikation im PDF-Format
Quelle und Grafik: viadonau