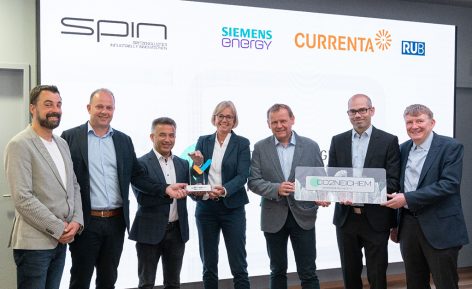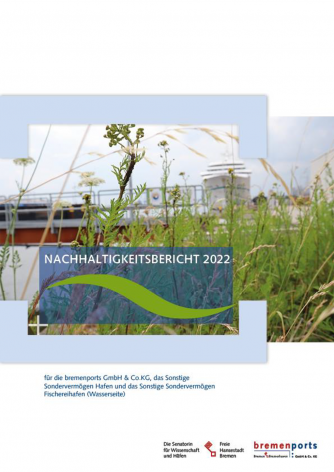Hamburg schließt Wasserstoff-Kooperationen

Hamburg wird beim Aufbau einer internationalen Wasserstoffwirtschaft künftig enger mit Chile, Uruguay und Argentinien zusammenarbeiten. Das ist das Ergebnis einer Reise des Ersten Bürgermeisters Dr. Peter Tschentscher nach Lateinamerika. Tschentscher unterzeichnete Vereinbarungen mit dem Energieministerium von Chile, dem Hafen von Montevideo und der Stadt Buenos Aires über eine engere Kooperation.
In Santiago de Chile, Montevideo und Buenos Aires traf sich Bürgermeister Tschentscher mit hochrangigen Vertreterinnen und Vertretern aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft. Im Mittelpunkt der Gespräche stand die Schaffung der beiderseitigen Voraussetzungen für den Import von grünem Wasserstoff aus Lateinamerika nach Deutschland über den Hamburger Hafen. Begleitet wurde Bürgermeister Tschentscher von Staatsrätin Almut Möller und einer 20-köpfigen Wirtschaftsdelegation.
Alle drei Länder bieten sehr gute Voraussetzungen für die Produktion von grünem Wasserstoff und sind zum Teil bereits Vorreiter bei der Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien. Als künftige Exporteure von grünem Wasserstoff haben sie das Potenzial, wichtige Partner für Hamburg zu werden, dessen Hafen zu einem europäischen Drehkreuz der internationalen Wasserstoffwirtschaft ausgebaut wird. In den Gesprächen wurde deutlich, dass Hamburg als Wirtschaftszentrum und Logistikknotenpunkt in Europa sowie mit dem geplanten Green Energy Hub von großem Interesse für Lateinamerika ist.
Bürgermeister Dr. Peter Tschentscher: „Grüner Wasserstoff ist ein zentraler Energieträger der Energiewende und ein wichtiges Zukunftsfeld für unsere Wirtschaft und Industrie. Hamburg hat das Ziel, ein führender Standort für den Import und den Handel mit Wasserstoff in Europa zu werden. Dafür brauchen wir gute Partner in der Welt. Chile, Uruguay und Argentinien haben beste Bedingungen für die Produktion von grünem Wasserstoff und verfolgen ambitionierte Strategien für den Wasserstoff-Export. Das Interesse an einer Zusammenarbeit mit Hamburg, unserem Hafen und den Unternehmen ist groß. Das deutsche System der dualen Berufsausbildung wird in den lateinamerikanischen Ländern als ein wichtiger Teil der künftigen Zusammenarbeit gesehen, um die Bildungschancen und Berufsperspektiven der jungen Menschen zu verbessern.
Bürgermeister Peter Tschentscher unterzeichnete zusammen mit dem chilenischen Energieminister Claudio Huepe und Friedrich Stuhrmann, Chief Commercial Officer der Hamburg Port Authority (HPA), im chilenischen Außenministerium eine Kooperationsvereinbarung, auf deren Grundlage ein strategischer Handelskorridor für grünen Wasserstoff aufgebaut werden soll. Die Vereinbarung sieht vor, dass Hamburg und Chile die erforderliche Infrastruktur, Technologien und Logistikketten für eine effiziente grüne Wasserstoffwirtschaft schaffen. Hierfür findet ein entsprechender Austausch zwischen Häfen, aber auch zwischen den politischen, wirtschaftlichen und wissenschaftlichen Institutionen statt.
In weiteren Gesprächen, unter anderem mit der Staatssekretärin des chilenischen Außenministeriums, Ximena Fuentes, dem Gouverneur der Metropolregion von Santiago de Chile sowie dem Präsidenten des chilenischen Industrieverbandes unterstrich die chilenische Seite das große Interesse an konkreten Projekten mit Hamburger Partnern, um den Aufbau der Wasserstoffwirtschaft in beiden Ländern zu fördern. Hamburg wird wegen seiner intensiven Lateinamerika-Kompetenz, der lange zurückreichenden Handelsbeziehungen und der zahlreichen persönlichen Verbindungen als Partner besonders geschätzt.
Bereits in seinem Gespräch mit dem uruguayischen Minister für Industrie, Energie und Bergbau, Omar Paganini, unterstrich der Erste Bürgermeister die Aktivitäten Hamburgs zur Einhaltung der Pariser Klimaziele. Uruguay gehört international zu den Vorreitern beim Ausbau der erneuerbaren Energien und sucht weltweit Partner, die ähnlich ambitioniert voranschreiten und Uruguay bei der Umsetzung ihrer Klimastrategie unterstützen. Tschentscher und Paganini verabredeten eine Fortsetzung des persönlichen Treffens und vereinbarten den Austausch von konkreten Projektvorschlägen für die Errichtung eines „grünen Korridors“ beim Transport von grünem Wasserstoff von Uruguay nach Hamburg.
Die Häfen von Hamburg und Uruguay wollen in Zukunft ihre Zusammenarbeit intensivieren, beim Aufbau einer Infrastruktur für den Im- und Export von grünem Wasserstoff ebenso wie in den Bereichen Umweltschutz und Emissionsreduktion. Hierzu schlossen Hafen Hamburg Marketing e. V. und die Hafenverwaltung von Uruguay in Montevideo ein Memorandum of Unterstanding. Es ist die dritte Kooperationsvereinbarung seit 2005.
In der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires, dem Ausgangspunkt der Lateinamerika-Reise, unterzeichnete Bürgermeister Peter Tschentscher mit seinem Amtskollegen Horacio Rodriguez Larreta eine erneuerte Kooperationsvereinbarung, auf deren Grundlage beide Städte ihre Zusammenarbeit in der Stadtentwicklung, beim Klimaschutz und bei der Digitalisierung vertiefen wollen. Hamburg und Buenos Aires hatten erstmals 2018 einen engeren Austausch vereinbart.
In seinen Gesprächen mit Mercedes Marcó del Pont, Staatssekretärin und strategische Beraterin des argentinischen Präsidenten, und Daniel Filmus, Minister für Wissenschaft und Technologie, erläuterte Bürgermeister Peter Tschentscher die Wasserstoff-Strategie des Hamburger Senats und verdeutlichte das Interesse Hamburgs und Deutschlands an langfristigen und stabilen Handelsbeziehungen mit Argentinien. Mit Filmus vereinbarte Tschentscher, die künftige handels- und logistikbezogene Kooperation im Bereich Wasserstoff um eine wissenschaftliche Zusammenarbeit zu ergänzen.
Quelle und Foto: Freie und Hansestadt Hamburg, Bürgermeister Peter Tschentscher unterzeichnete zusammen mit dem chilenischen Energieminister Claudio Huepe und Friedrich Stuhrmann, Chief Commercial Officer der Hamburg Port Authority (HPA) im chilenischen Außenministerium eine Kooperationsvereinbarung, auf deren Grundlage ein strategischer Handelskorridor für grünen Wasserstoff aufgebaut werden soll.