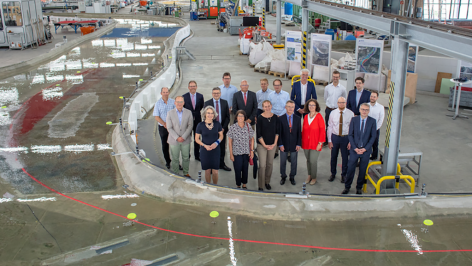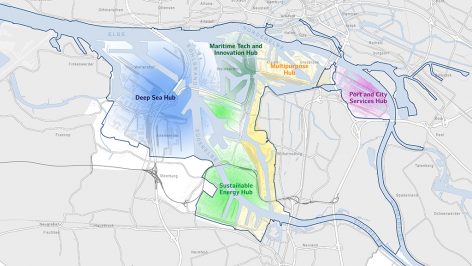Die Mittel für den Ausbau der Flüsse und Kanäle in Deutschland werden im nächsten Jahr erneut nicht ausreichen, um sämtliche dringend erforderliche Maßnahmen im Wasserstraßennetz in Angriff zu nehmen. Das geht aus dem Entwurf des Bundeshaushaltes 2024 hervor, den die Regierung in dieser Woche beschließen wird. Der viel zu geringe 2023er-Ansatz von 595 Mio. Euro für „Ersatz-, Ausbau- und Neubaumaßnahmen an Bundeswasserstraßen“ wird lediglich um rund 130 Mio. Euro auf 724 Mio. Euro angehoben. Für Erhaltungsmaßnahmen sind 450 Mio. Euro vorgesehen.
Den Bundesverband der Deutschen Binnenschifffahrt e.V. (BDB) stellt das nicht zufrieden: Die Bundesregierung hat im Mai 2023 auf eine Anfrage im Bundestag mitgeteilt, dass sie für die Wasserstraßen rund 1,7 Mrd. Euro benötigt, und dass der geringe Mittelansatz im laufenden Jahr bereits „die Verschiebung und Streckung von Investitionsmaßnahmen“ erfordert. Es besteht laut Auskunft der Bundesregierung „kurz- bis mittelfristiger Handlungsbedarf an 70 Wehranlagen, 130 Schleusenanlagen und 160 Brücken“ (BT-Drucksache 20/6752).
„Obwohl der Zustand der Wasserstraßen und die Investitionsnotwendigkeiten der Regierung bestens bekannt sind, werden die erforderlichen Mittel erneut nicht zur Verfügung gestellt. Die wenigen Ausbauprojekte, die im Wasserstraßenbereich vorgesehen sind, werden sich damit deutlich verzögern. Das ist unbefriedigend und wird einmal mehr dazu führen, dass die Güterschifffahrt ihr Leistungspotenzial nicht entfalten kann. Das visionslose Kaputtsparen der Wasserstraße wird die unter der Ampel-Regierung eingeleitete Deindustrialisierung und Verkehrsverlagerung hin zur Straße weiter befeuern. So wird das nichts mit der schnellen Beseitigung von Engpässen und der erhofften Verkehrsverlagerung und dem Klimaschutz im Gütertransport“, kommentiert BDB-Präsident Martin Staats (MSG, Würzburg) den Haushaltsentwurf.
Bei den Maßnahmen zur Förderung des Schifffahrtsgewerbes schreibt die Bundesregierung in dem Entwurf die gegebenen Etatansätze nahezu unverändert fort, etwa im Bereich der Flottenmodernisierung oder der Aus- und Weiterbildung. Die Mittel für Zuschüsse an private Unternehmen für Investitionen in den Kombinierten Verkehr werden um 15 Mio. Euro auf 77 Mio. Euro angehoben. Maßnahmen für die Verlagerung von Großraum- und Schwerguttransporten (GST) von der Straße auf die Wasserstraße sollen mit einem Gesamtetat von 2 Mio. Euro bezuschusst werden.
Der Branchenverband VDV bewertet den Mittelansatz für die Schiene im vorliegenden Entwurf des Bundeshaushalts für das kommende Jahr differenziert: Ein Schritt in die richtige Richtung ist der Zuwachs der Mittel um insgesamt rund 3 Milliarden Euro. Dennoch bleibt der Ansatz damit deutlich hinter den im März im Kabinett beschlossenen 45 Milliarden Euro zusätzlich bis 2027. Im Begleitschreiben des Bundesfinanzministeriums heißt es zudem, dass aus den Mehreinnahmen der LKW-Maut zusätzlich 5,4 Milliarden Euro in die Schiene fließen sollen. Wenn aber insgesamt fürs kommende Haushaltsjahr nur 3 Milliarden mehr eingeplant sind, wo sind dann die restlichen Mittel aus der LKW-Maut?
VDV-Präsident Ingo Wortmann: „Es ist ein gutes Signal der Bundesregierung, dass in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten insgesamt mehr Mittel für die Schiene zur Verfügung gestellt werden. Allerdings wurden im März vom Kabinett noch 45 Milliarden Euro zusätzlich bis 2027 beschlossen. Würde man diese gleichmäßig auf die kommenden vier Jahre verteilen, dann müssten eigentlich jährlich 11,25 Milliarden Euro zusätzlich bereitgestellt werden. Im kommenden Jahr sollen es jedoch nur 3 Milliarden Euro mehr sein. Damit verschiebt man die Finanzierungsnotwendigkeiten des Eisenbahnsystems in Deutschland weiter in die Zukunft und die Planungen der Unternehmen bleiben kurzfristig und risikobehaftet. Das ist nicht zielführend für die bis 2030 angestrebten und im Koalitionsvertrag festgelegten Wachstumsziele der Branche. Die Hoffnung auf weitere Mittel aus dem Klima- und Transformationsfonds ist angesichts der dort bereits aus anderen Politikressorts angemeldeten Bedarfe aktuell nicht sehr groß. Da braucht es jetzt ein klares Bekenntnis des Bundesfinanz- und des Bundesverkehrsministers, dass die fehlenden Mittel für die Schiene definitiv aus diesem Fonds bereitgestellt werden. Und auch für den Ausbau- und Modernisierungspakt, mit dem die dringenden Kapazitäts- und Angebotsausweitungen im ÖPNV umgesetzt werden sollen, fehlt weiterhin jegliche Finanzierungssicherheit im Bundeshaushalt.“
Die zusätzlichen drei Milliarden Euro führen dazu, dass in vielen der einzelnen Positionen im „Einzelplan 12“ die Mittel für die Schiene steigen. Der VDV bewertet dabei vor allem die zusätzlichen Gelder für die Förderung von ETCS, Infrastruktur der nichtbundeseigenen Eisenbahnen und Gleisanschlüssen positiv. Sehr positiv ist aus VDV-Sicht, dass die Trassenpreisförderung für den Schienengüterverkehr nicht halbiert wird, sondern mit 350 Mio. Euro auch 2024 fast auf demselben Niveau bleibt wie in diesem Jahr (370 Mio. Euro). „Für den Schienengüterverkehr gibt es einige positive Ansätze im kommenden Bundeshaushalt, das begrüßen wir, denn gerade der Schienengüterverkehr braucht dringend die Unterstützung des Bundes aber auch der Länder, wenn nachhaltig mehr Güter auf die Eisenbahn verlagert werden sollen“, so Wortmann abschließend.
Der Vorsitzende des DVF-Präsidiums Prof. Dr.-Ing. Raimund Klinknersieht den Verkehrsetat im Entwurf des Bundeshaushalts 2024 als nicht ausreichend an: „Zwar wächst der Verkehrshaushalt laut Plan angesichts der angespannten Haushaltslage immerhin um 3 Milliarden Euro. Dieser Aufwuchs wird jedoch durch die Verdopplung der Lkw-Maut von den Unternehmen des Straßengüterverkehrs bezahlt und kommt dem Verkehrshaushalt somit unter dem Strich noch nicht einmal zur Hälfte zugute.“ Schließlich lägen die durch die Maut erwarteten Mehreinnahmen bei gut 7 Milliarden Euro. „4 Milliarden Euro Mautmehreinnahmen sind im allgemeinen Bundeshaushalt anderweitig verwendet worden. Das steht im klaren Widerspruch zum Versprechen, dass die Mautmehreinnahmen dem Verkehrshaushalt zugute kommen sollten“, kritisiert Klinkner.
Damit lasse sich auch die Investitionslücke von fast 97 Milliarden Euro (inkl. Baukostensteigerungen), die sich seit 2015 allein für die Projekte im Bundesverkehrswegeplan aufgetan habe, nicht schließen. Das bedeute, dass weder die kürzlich vorgestellte Langfristprognose des Bundesverkehrsministeriums und schon gar nicht die Verlagerungsziele der Koalition auf Schiene und Wasserstraße realisierbar seien. „So wird Deutschland weder seine Klimaziele erreichen noch als Wirtschaftsstandort wettbewerbsfähig bleiben können“, warnte Klinkner eindringlich. Der DVF-Präsident forderte, dem Verkehrshaushalt die Lkw-Maut komplett zusätzlich zur Verfügung zu stellen.
„Die notwendigen Investitionshöhen für den Erhalt, Aufbau und die Modernisierung von Schiene, Straße, Wasserstraße und Digitales sind bekannt, sind aber in der Finanzplanung des Bundes nicht enthalten: Für den Schienenverkehr geht es um zusätzliche 45 Milliarden Euro in den nächsten 4 Jahren. Der Haushalt sieht für 2024 sowie an Verpflichtungsermächtigungen bis 2027 nicht einmal die Hälfte für Investitionen in Erhalt und Ausbau der Schienenwege vor – und das auch noch nicht einmal zusätzlich! Die Bundesfernstraßen brauchen alleine für die Brücken jährlich 2,5 Milliarden Euro zusätzlich. Tatsächlich aber stagniert der Etat für Investitionen in die Bundesfernstraßen. Die Wasserstraßen benötigen jährlich Investitionen in Höhe von 2 Milliarden Euro, um zukunftsfähig zu sein. Die für Erhalt und Ausbau eingeplanten 1,2 Milliarden Euro decken den Bedarf nicht. Ebenso wurden die Mittel für den Radverkehr um 150 Millionen Euro gekürzt. Auch die Baukostensteigerungen müssen Berücksichtigung finden, sonst sinken die Investitionen real. Dieser Haushaltsentwurf ist mutlos. Wir brauchen aber einen Kraftakt für unsere Zukunftsfähigkeit!“
Noch nicht vorgelegt wurde der Wirtschaftsplan 2024 für den Klima- und Transformationsfonds (KTF). Angesichts der großen Herausforderungen der Dekarbonisierung im Verkehrssektor sind die Mittelzuweisungen aus dem KTF von großer Bedeutung. Bei allen Verkehrsträgern muss massiv in die Umstellung der Antriebe und Kraftstoffe und in die erforderliche Infrastruktur investiert werden. Hier muss auch der Luftverkehr Berücksichtigung finden, der ansonsten seine Infrastrukturkosten selbst trägt.
Quelle: BDB, VDV, DVF, Foto: BDB