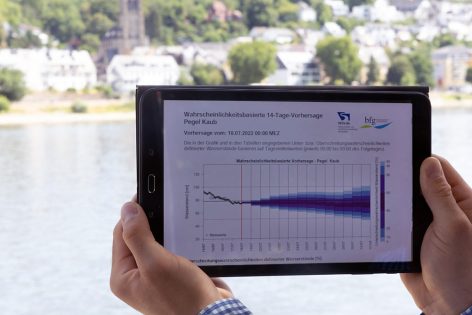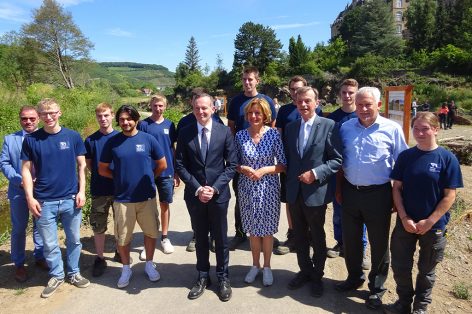schwimmendes Flüssiggasterminal am Standort Brunsbüttel

Bereits um den Jahreswechsel 2022/2023 soll am Elbehafen Brunsbüttel ein schwimmenden Flüssiggasterminal entstehen. Das FSRU-Terminal (Floating Storage and Regasification Unit) wird einen entscheidenden Beitrag zur Absicherung der Gasversorgung in Deutschland leisten. Die am Projekt beteiligten Unternehmen und Genehmigungsbörden arbeiten mit Hochdruck an dessen Realisierung.
Dazu sind bis zum Jahreswechsel die Zulassungsverfahren für den Anleger des Flüssiggasterminals (Jetty) sowie Genehmigungsprozesse für den Betrieb der Anlage am Standort abzuschließen. Außerdem muss zusätzliche Infrastruktur in Form von Anbindungsleitungen, Warmwasserleitungen und ein Landstromanschluss genehmigt und gebaut werden. Das Projekt wird daher in mehreren Phasen umgesetzt.
„Die Gasversorgungslage in Deutschland ist ernst. In dieser schwierigen Phase rücken der Bund und das Land Schleswig-Holstein noch enger zusammen. Gemeinsam schaffen wir die Voraussetzungen, den Gasbezug in unserem Land weiter zu diversifizieren. Die LNG-Infrastruktur in Brunsbüttel wird einen wichtigen Beitrag leisten, künftig ohne russisches Gas auszukommen“, unterstrich Minister Goldschmidt die Bedeutung des Projektes.
Mit dem LNG-Beschleunigungsgesetz hat die Bundesregierung die gesetzliche Grundlage für den beschleunigten Bau von Flüssiggasinfrastruktur geschaffen. Die kürzeren Genehmigungsverfahren finden nun erstmals auch in Schleswig-Holstein Anwendung. Damit soll das ehrgeizige Ziel der Inbetriebnahme zum Jahreswechsel 2022/2023 erreicht werden.
Das FSRU selbst kann ein Volumen von etwa 5 Mrd. m³ pro Jahr aufnehmen und regasifizieren. Aufgrund der Netzkapazitäten wird diese Menge von 5 Mrd. m3 pro Jahr in der ersten Projektphase im Winter erreicht, im Sommer 2023 wird es jedoch zunächst etwas weniger sein, so dass man in der ersten Phase auf einen Jahresdurchschnitt von 3,5 Mrd. m³ pro Jahr kommt. Nach Bau und Inbetriebnahme einer neuen, 55 Kilometer langen Gasleitung kann ab Ende 2023 die Kapazität gesteigert werden, so dass dann das volle Volumen des Schiffes in Höhe von 5 Mrd. m3 pro Jahr auch über das komplette Jahr realisiert werden kann.
„Es ist ein komplexes Unterfangen, bei dem wir mehrere Bauprojekte parallel planen – von Terminals bis hin zum gleichzeitigen Bau von zwei Gasleitungen. Wir wollen schon kurzfristig LNG ins deutsche Gasnetz einspeisen und mittelfristig die Kapazitäten aus dem FSRU mehr als verdoppeln. Dass wir dieses ehrgeizige Projekt so entschieden angehen können, haben wir auch der Brunsbüttel Ports GmbH zu verdanken. Wir wissen, dass der mehrstufige Realisierungsprozess mit seinen Übergangslösungen ebenfalls mit Zumutungen für die Kunden des Hafens verbunden ist. Es macht Mut zu sehen, wie Wirtschaft und Politik diese Kraftanstrengung gemeinsam angehen“, lobte Goldschmidt die große Kooperationsbereitschaft aller Akteure.
Gleichzeitig zeigte er Verständnis für die Kritik von Umweltverbänden und lokalen Initiativen an den beschleunigten Planungs- und Genehmigungsprozessen: „Ich kann gut nachvollziehen, dass weder das Projekt an sich noch die Verfahrensverkürzungen Begeisterungsstürme auslösen. Aber die Energieversorgungslage ist nun einmal wie sie ist: bitterernst“, so Goldschmidt. Dabei verwies er nochmals auf die Veröffentlichung der Planunterlagen für die ETL 180 Brunsbüttel-Hetlingen und ETL 185 Brunsbüttel-FSRU, die seit dem 19.07.22 einsehbar sind.
Die drei Phasen des Projektes, die zum Teil parallel starten, laufen wie folgt ab.
Phase 1:
Da im Hafen aktuell kein freier Anleger für das FSRU zur Verfügung steht, wird vorübergehend der bestehende Gefahrstoffanleger genutzt und dafür kurzfristig umgebaut (Interimslösung). Die Bautätigkeiten für die Interimslösung beginnen Anfang September dieses Jahres. Anfang Oktober startet zudem der Bau der drei Kilometer langen Erdgastransportleitung (ETL) 185, die bis zum Jahreswechsel fertig gestellt wird. Über diese Leitung werden dann nach Inbetriebnahme im Jahresdurchschnitt Gaslieferungen in Höhe von 3,5 Mrd. m³ pro Jahr ins Netz eingespeist, wobei es im Winter etwas mehr ist als im Sommer. Im Winter liegt der Wert bei 5 Mrd. m3 pro Jahr, im Sommer dann etwas weniger. Der Jahresdurchschnittswert von 3,5 Mrd. m3 pro Jahr entspricht in dieser Phase des Projekts in etwa vier Prozent des deutschen Gasbedarfs.
Phase 2:
In einer zweiten Phase folgt der Bau der neuen Anlegestelle. Dieser beginnt schon im November 2022 und soll im März 2023 fertig gestellt werden. Dann wird das FSRU von diesem neuen Terminal aus Gas über die drei Kilometer lange Leitung ins Netz einspeisen, so dass der Gefahrstoffanleger wieder für seine bisherigen Zwecke, etwa Ölanlieferungen zur Verfügung steht.
Phase 3:
Um die Gaskapazität in Brunsbüttel noch mal deutlich zu steigern, wird eine dritte Phase in Angriff genommen: der Bau der 55 Kilometer langen ETL 180 von Brunsbüttel nach Hetlingen/Stade, die das FSRU mit dem deutschen Gasfernleitungsnetz verbindet. Der Baubeginn der ETL 180 ist ebenfalls für November 2022 vorgesehen; die Projektverantwortlichen erwarten die Inbetriebnahme im Dezember 2023. Die neuen Gasleitungen sind perspektivisch für den Transport von Wasserstoff- bzw. Wasserstoffderivaten nutzbar (Wasserstoff-ready). In Folge der Anbindung können ab Ende 2023 Gaslieferungen dann in voller Höhe der Kapazität des Schiffes in das deutsche Gasnetz eingespeist werden – das heißt in Höhe von 5. Mrd. m3 pro Jahr.
Parallel zu den Arbeiten für die Flüssiggasinfrastruktur laufen die Genehmigungen eines landbasierten LNG-Terminals und die erforderliche wasserseitige Infrastruktur. Nach dessen voraussichtlicher Fertigstellung (2026) und dem Abzug des FSRU können jährlich bis zu zehn Milliarden m³ Gas importiert werden. Das landbasierte LNG-Terminal wird perspektivisch mit entsprechenden Umrüstungen den Import klimaneutraler Energieträger, insbesondere Wasserstoff bzw. Wasserstoffderivate ermöglichen.
Minister Goldschmidt betonte die zentrale Bedeutung des Industrieparks Brunsbüttel für die Wirtschaft Schleswig-Holsteins. Dabei unterstrich er auch dessen Potenziale für die Transformation des Bundeslandes hin zu einem klimaneutralen Industrieland: „Viele Industrieunternehmen in Schleswig-Holstein, die noch fossil produzieren, haben bereits Pläne umzusteigen. Durch den günstigen Zugang zu erneuerbaren Energien und der Hafenanbindung bietet die Westküste ideale Bedingungen für die Weiterentwicklung vorhandener Unternehmen und die Ansiedlung neuer Produktionsbetriebe. Schleswig-Holstein wird diese Chancen nutzen. Wir werden die LNG-Infrastruktur zu einem Multi-Energie-Terminal für erneuerbare Treibstoffe ausbauen“, so Goldschmidt.
Quelle: Ministerium für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur Schleswig-Holstein, Foto: Brunsbüttel Ports GmbH