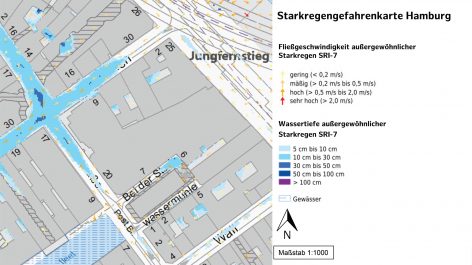BDB unterstützt „Weckruf der Verbände“

Der Bundesverband der Deutschen Binnenschifffahrt e.V. (BDB) unterstützt das mit 20 weiteren Verbänden aus den Bereichen Verkehr, Wirtschaft und Logistik unter der Federführung des Deutschen Verkehrsforums initiierte Positionspapier „Weckruf der Verbände: Bundeshaushalt muss der verkehrlichen Realität standhalten“.
Darin wird der dringende Appell an die Bundesregierung gerichtet, die Budgets für die Erhaltung der Verkehrswege im Bundeshaushalt 2025 auf dem Niveau des Jahres 2024 – zuzüglich der einzupreisenden massiven Baukostensteigerungen – fortzuführen. Hintergrund ist, dass die Ampelkoalition nach Informationen der Verbände plant, die Verkehrsinvestitionen ab 2025 zu kürzen. Dies steht im krassen Widerspruch zum von der Regierung formulierten Ziel, die verkehrlichen Infrastrukturen klimaresilient und leistungsfähig aufzustellen, um diese fit für die Zukunft zu machen, auch im Bereich der Digitalisierung.
Neben Straße und Schiene wären auch die Wasserstraßen massiv von weiteren Kürzungen betroffen, zum Beispiel bei der nicht mehr aufschiebbaren Sanierung der Schleusen im westdeutschen Kanalnetz. Dies hätte enorme Auswirkungen auf den Industrie- und Wirtschaftsstandort Deutschland. Insbesondere die Großindustrie in den Bereichen Chemie, Stahl und Mineralöl ist essenziell auf die Güterschifffahrt als verlässlichen Logistikpartner angewiesen. Gleiches gilt für den Transport von Agrargütern, Baustoffen sowie Halb- und Fertigwarenerzeugnissen in Containern.
Bereits im laufenden Haushaltsjahr 2024 reicht die für Erhalt, Aus- und Neubau der Bundeswasserstraßen zur Verfügung stehende Summe von rund 725 Mio. Euro nicht einmal aus, um den Substanzerhalt zu finanzieren. Der Bedarf hierfür wurde im Jahr 2015 von der damaligen Regierung auf rund 900 Mio. Euro pro Jahr beziffert. Dabei sind dringend benötigte Aus- und Neubauvorhaben wie die „Abladeoptimierung Mittelrhein“ noch nicht einmal berücksichtigt. Gemeinsam mit der Gewerkschaft Verdi hatte der BDB bereits Anfang des Jahres 2023 darauf hingewiesen, dass eine Finanzausstattung von deutlich über 2 Mrd. Euro jährlich nötig ist, damit die zuständige Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes (WSV) mit ihren 12.000 Beschäftigten ihre verkehrlichen und ökologischen Aufgaben tatsächlich erbringen kann.
Die WSV nimmt vielfältige und unverzichtbare Aufgaben für die Unterhaltung der Bundeswasserstraßen wahr. Rund 7.500 km dieser Wasserstraßen, das sog. „Kernnetz“, sind für die gewerbliche Binnenschifffahrt relevant. So ist die WSV u.a. zuständig für rund 350 Schleusenanlagen, 300 Wehre, vier Schiffshebewerke und 1.000 Brücken. Viele dieser Bauwerke sind jedoch mittlerweile überaltert und in schlechtem oder gar kritischem Zustand. Rund 60 Prozent aller Schleusen wurden vor 1950 gebaut. Es besteht dringender Handlungsbedarf, denn: Fällt ein Teil der Wasserstraßeninfrastruktur aus, droht ein schwerer Schaden für den Wirtschaftsstandort Deutschland und die hier ansässige Großindustrie. Bei Betroffenheit von Wehren drohen mithin sogar Gefahren für Leib und Leben der Bevölkerung, da diese dem Hochwasserschutz dienen und Überschwemmungen verhindern. Die Bundesregierung muss daher den Bundeswasserstraßen und deren Finanzierung endlich deutlich höhere Priorität einräumen.
Das gemeinsame Positionspapier von BDB und Verdi mit vertiefenden Hinweisen zu den Handlungsnotwendigkeiten bei der Ertüchtigung der Wasserstraßeninfrastruktur und der Personalausstattung in der WSV kann unter folgendem Link abgerufen werden: BDB-Verdi-Positionspapier 2023
Quelle und Foto: BDB, der Neubau einer zweiten Schleusenkammer bei Zerben am Elbe-Havel-Kanal dient der Ertüchtigung der Wasserstraße Magdeburg-Berlin für 2,80 m Abladetiefe. Auf dem Kanal werden pro Jahr rund 2 Mio. Tonnen Güter transportiert.