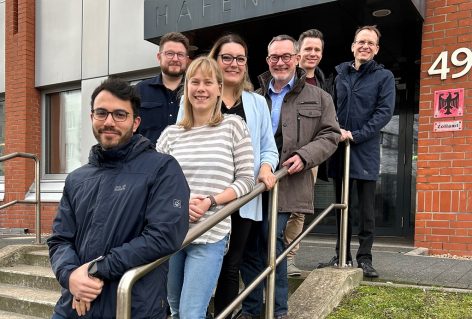Für den gesetzlich festgelegten Ausbau der Offshore-Windenergie auf 30 Gigawatt bis 2030 und 70 Gigawatt bis 2045 reichen die Hafenkapazitäten entlang der deutschen Küste nicht aus. Geld für eine Erweiterung der Häfen könnten die Einnahmen aus Offshore-Wind-Auktionen liefern. Deshalb fordern der Bundesverband Windenergie Offshore (BWO) und der Zentralverband der deutschen Seehafenbetriebe (ZDS) im Schulterschluss mit den Küstenländern die Bundesregierung auf, gemeinsam an einer pragmatischen und schnellen Lösung für die Finanzierung dieses Ausbaus zu arbeiten.
„Es ist gut, dass die Bundesregierung für die Verwendung der Einnahmen aus den Offshore-Wind-Auktionen eine Transformationskomponente einführen will. Diese sollte unter anderem dafür verwendet werden, den Ausbau der Häfen und deren Hinterlandanbindung zu finanzieren. Damit flankieren wir den Ausbau der Offshore-Windenergie und gewährleisten Versorgungssicherheit mit kostengünstigem Strom aus Offshore-Windenergie – für ganz Deutschland. Offshore-Wind-Basishäfen sowie Häfen, die perspektivisch für den Rückbau ausgedienter Windenergieanlagen genutzt werden, können zudem von der Ansiedlung zahlreicher Unternehmen aus der Lieferkette profitieren“, sagt BWO-Geschäftsführer Stefan Thimm.
„Ohne die deutschen Seehäfen sind die geplanten Ausbauziele für Offshore-Windenergie nicht zu erreichen. Mit Blick auf den angepeilten Hochlauf der Leistung aus Windenergie auf See müssen daher schnell die politischen Weichen für den Ausbau von Schwerlastflächen in den Seehäfen gestellt werden. Hier ist vor allem der Bund in der Pflicht, finanziell seinen Anteil zum Gelingen der Energiewende zu leisten. Eine Verwendung der Erlöse aus der Vergabe der Offshore-Lizenzen für Windparks auf See wäre inhaltlich naheliegend und würde den Bundeshaushalt nicht weiter belasten. Wir können es uns mit Blick auf die Ausbauziele nicht erlauben, die nötigen politischen Entscheidungen weiter zu vertagen“, sagt Angela Titzrath, Präsidentin des Zentralverbandes der deutschen Seehafenbetriebe.
„Die Häfen sind das Herzstück der Energiewende, denn sie sind die Voraussetzung für das Gelingen der Ausbauziele. Der EnergyPort, den wir in Bremerhaven planen, ist dafür ein sehr gutes Beispiel. Er etabliert den Hafen als Schlüsselstandort für die Offshoreindustrie und auch als Knotenpunkt für den Im- und Export erneuerbarer Energien. Damit sind große Wertschöpfungspotenziale verbunden, weil sie erhebliche Ansiedlungs- und Beschäftigungseffekte mit sich bringen“, sagt Kai Stührenberg, Staatsrat für Häfen bei der Senatorin für Wirtschaft, Häfen und Transformation, Bremen.
„Die Herausforderungen der Klimakrise und die hohen Ziele, die wir uns für den Ausbau der erneuerbaren Energien in Deutschland gesteckt haben, können wir nur gemeinsam bewältigen. Eine gute Energieversorgung ist entscheidend für den gesamten Industriestandort, daher ist es unabdingbar, dass wir uns in Deutschland gemeinsam gut aufstellen. Auch Hamburg als die deutsche Windhauptstadt mit einer hohen Konzentration an Unternehmen und Einrichtungen, die die gesamte Wertschöpfungskette der Windenergie abbilden, hat ein großes Interesse an der Dekarbonisierung seiner Industrie. Der Ausbau der Windenergie und die leistungsfähigen deutschen Seehäfen sind dabei ein zentraler Faktor“, sagt Dr. Melanie Leonhard, Hamburgs Senatorin für Wirtschaft und Innovation.
„Die Häfen in Mecklenburg-Vorpommern vollführen derzeit einen großen Strukturwandel. Es ist sehr deutlich, dass die Häfen von zentraler Bedeutung für den im Koalitionsvertrag des Bundes festgehaltenen Ausbau der Offshore-Windenergie sind. Wir sind bereits, unseren Teil dazu beizutragen, indem die Häfen in Sassnitz-Mukran und Rostock als Installations- und Service- beziehungsweise Zuliefererstandorte etabliert und gestärkt werden. Dafür ist es notwendig, dass die Häfen in den nächsten Jahren kontinuierlich an die Anforderungen des Ausbaus angepasst werden. Dabei brauchen wir die Unterstützung des Bundes“, sagt Reinhard Meyer, Minister für Wirtschaft, Infrastruktur, Tourismus und Arbeit des Landes Mecklenburg-Vorpommern.
„Der Ausbau des Hafens in Cuxhaven mit zusätzlichen Liegeplätzen ist bereits genehmigt, und das Land Niedersachsen hat zugesagt, sich wie der Hafenbetreiber mit 100 Millionen Euro am Ausbau des Deutschen Offshore-Industrie-Zentrums DOIZ in Cuxhaven zu beteiligen. Wir müssen dafür sorgen, dass der Finanzbedarf unserer Häfen verlässlich gesichert wird und dass sich der Bund finanziell einbringt. Wir kennen den Ausbaubedarf der Häfen entlang unserer Küste und sollten die Chance nutzen, das Projekt zu realisieren und den Ausbau weiterer Standorte zu unterstützen“, sagt Olaf Lies, Niedersächsischer Minister für Wirtschaft, Verkehr, Bauen und Digitalisierung.
“Schleswig-Holstein ist Windkraftland zwischen zwei Meeren. Unsere Häfen an der Westküste können eine noch stärkere Funktion für die Energiewende für ganz Deutschland einnehmen. Wartung, Instandsetzung oder auch Rückbau und Recycling von Offshore-Windkraftanlagen können ideal von dort abgewickelt werden. Schleswig-Holstein steht bereit den Offshore-Unternehmen ein guter Standort zu sein”, sagt Tobias Goldschmidt, Minister für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur des Landes Schleswig-Holstein.
Quelle: Bundesverband Windenergie Offshore (BWO), Zentralverband der deutschen Seehafenbetriebe (ZDS), Senatorin für Wirtschaft, Häfen und Transformation, Bremen, Senatorin für Wirtschaft und Innovation, Hamburg, Minister für Wirtschaft, Infrastruktur, Tourismus und Arbeit, Mecklenburg-Vorpommern, Minister für Wirtschaft, Verkehr, Bauen und Digitalisierung, Niedersachsen, Minister für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur, Schleswig-Holstein, Foto: NPorts/ Christian O Bruch