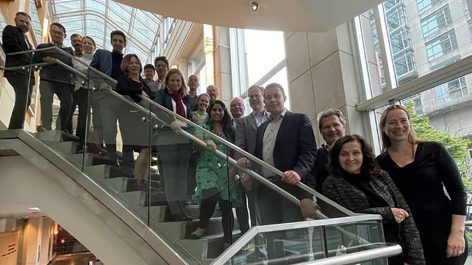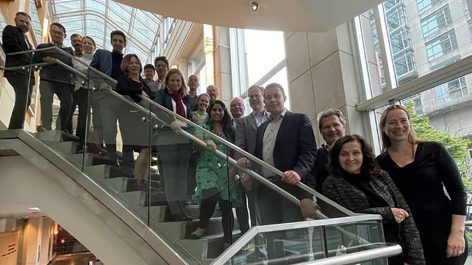
Der Landstrom ist auf dem Vormarsch. In einer wachsenden Zahl von Häfen wird die Stromversorgung der angelegten Schiffe zu einem erwachsenen Bestandteil der Infrastruktur. Mit Landstrom können Schiffe mit (erneuerbarem) Strom für die Nutzung von Geräten und die Beleuchtung an Bord versorgt werden.
Dieselgeneratoren und Hilfsmotoren können dadurch abgeschaltet werden. Dadurch wird der Ausstoß von CO2, Stickstoff und Feinstaub verringert und die Lärmbelästigung in der unmittelbaren Umgebung reduziert.
Vertreter des World Ports Climate Action Program (WPCAP) besuchten kürzlich den Hafen von Vancouver, unter anderem im Zusammenhang mit der dort stattfindenden IAPH Welthafenkonferenz. Die Teilnehmer konnten mit eigenen Augen sehen, wie Container- und Kreuzfahrtschiffe an das Landstromnetz im westkanadischen Hafen angeschlossen werden.
„Mit Steckern, die etwa fünfzehn Kilo wiegen, um den Anschluss an das 6,6-kV-Netz sicher verlaufen zu lassen“, so Jarl Schoemaker vom Hafenbetrieb Rotterdam und Vorsitzender der WPCAP-Landstrom-Arbeitsgruppe. Schoemaker war mit einer Reihe von Vertretern in Vancouver zum WPCAP-Treffen, bei dem die Arbeitsgruppen die Fortschritte besprechen und Vereinbarungen über das weitere Vorgehen in den verschiedenen Phasen treffen.
Das WPCAP konzentriert sich auf Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels im maritimen Sektor. Das Hafennetzwerk wurde 2018 auf der Weltklimakonferenz in San Francisco gegründet. Mit Antwerpen, Barcelona, Göteborg, Hamburg, HAROPA Le Havre, Long Beach, Los Angeles, New York / New Jersey, Rotterdam, Valencia, Vancouver und Yokohama bieten die Mitgliedshäfen eine große geografische Streuung. Im Rahmen des WPCAP arbeiten verschiedene Koalitionen an spezifischen Projekten, an denen möglichst viele Schifffahrtsunternehmen, Terminals und Energieversorger beteiligt sind, um eine maximale Wirkung zu erzielen.
In Kanada hat die Landstrom-Arbeitsgruppe weitere Fortschritte erzielt. „Vancouver verfügt bereits über Landstrom für Containerschiffe und die Kreuzfahrtindustrie, die alle zu fast 100 % aus Wasserkraft gespeist werden. Durch die Zusammenarbeit mit einer Vielzahl von Häfen in diesem Bereich stellen wir fest, dass der Wissensstand in Bereichen wie Technik, Betrieb, Sicherheit, aber auch Kostenmodelle zunimmt. Entscheidend ist jedoch, dass immer mehr Schiffe für den Empfang des Stroms vorbereitet werden.“
Zusätzlich zu den bestehenden Anlagen in Vancouver und Los Angeles haben die Häfen von Antwerpen, Bremerhaven, Hamburg, HAROPA Port und Rotterdam Anfang letzten Jahres beschlossen, das Tempo zu erhöhen, um große Containerschiffe, die im Jahr 2028 anlegen, mit Landstrom zu versorgen. Außerdem wurde ein „Schiffseignermodul“ entwickelt, um den Kostenunterschied zwischen Landstrom und Schiffskraftstoffen zu ermitteln. Dies zeigt auch, dass Landstrom kostengünstig, robust und zukunftssicher ist, insbesondere für große Energieverbraucher.
Die Fortschritte der WPCAP-Arbeitsgruppe führen auch zu Innovationen bei neuen Systemen. Schoemaker: „Wir befassen uns derzeit mit einem effektiven Wissensaustausch, der weltweiten Verbreitung der Landstromversorgung und Möglichkeiten zur Verbesserung des technischen Standards. Zu diesem Zweck sind wir u. a. mit der International Electrotechnical Commission im Gespräch, die alle Normen für elektrische und elektronische Geräte festlegt. Wir sehen Verbesserungsmöglichkeiten und können bei der Einführung von Landstromprogrammen in Häfen weltweit helfen. Dies ist zum Beispiel in Europa sehr hilfreich, wo die Europäische Kommission im Rahmen ihres Programms Fit for 55 Landstromanforderungen für Containerschiffe, Kreuzfahrtschiffe und Fähren einführt. Aber es regt auch andere Häfen an, da wir ein wirklich gutes Paket in der Hand haben, das die Einführung erleichtert und auch beschleunigen kann.“
Er unterstreicht einmal mehr, dass sich das WPCAP zu einer Plattform für Klimaschutzmaßnahmen im maritimen Sektor entwickelt hat, nicht nur in Form von Wissensentwicklung, sondern auch in Bezug auf die praktische Anwendung.
Ein weiterer Bereich, in dem sich das WPCAP aktiv engagiert, ist die Vorbereitung der Häfen auf die Abfertigung von Schiffen mit alternativen Kraftstoffen. In Anbetracht des vielfältigen Brennstoffmixes der Zukunft ist es für die Häfen, die zwischen verschiedenen Aspekten navigieren müssen, eine komplizierte Landschaft, darunter Sicherheit, Verwaltung, gesellschaftliches Engagement und kommerzielle Faktoren. Diese Faktoren können sich je nach den vom Hafen angebotenen Dienstleistungen unterscheiden, die von einfachen Port Calls bis hin zu Bunkerung, Wartung und industriellen Dienstleistungen reichen.
„Für ein ankommendes Schiff, das Ammoniak verwendet, gelten andere Vorschriften als für ein Schiff, das Wasserstoff bunkern will, oder ein E-Methanol-Schiff, das repariert werden muss“, erklärt Cees Boon vom Rotterdamer Hafen.
Die WPCAP-Arbeitsgruppe für alternative Kraftstoffe ist sich bewusst, dass es andere Organisationen gibt, die ebenfalls versuchen, die Herausforderungen in der zukünftigen Landschaft anzugehen und Möglichkeiten für Häfen zu identifizieren. Zu diesen Organisationen gehören unter anderem die International Association of Ports and Harbors (IAPH) über ihre Clean Marine Fuels (CMF)-Gruppe, die Getting to Zero Coalition und unter anderem wissenschaftliche Einrichtungen.
Vertreter der Arbeitsgruppe wurden zur Teilnahme an der IAPH-CMF-Versammlung eingeladen, bei der es um Bunker-Checklisten und Audit-Instrumente ging. Die IAPH-Gruppe hat den Grundstein für die Schaffung eines Sicherheitsrahmens für die Verwendung alternativer Kraftstoffe durch Schiffe in Häfen gelegt. Die Diskussion mit WPCAP konzentrierte sich auf den nächsten Schritt hin zu einem Instrument, um dies in Häfen zu ermöglichen. Es wurde vereinbart, dass WPCAP dieses Instrument entwickeln würde.
Boon wurde dazu angeregt, das bereits als Industriestandard etablierte TRL-Instrument (Technical Readiness Level) zu nutzen, um einen Port Readiness Level-Indikator für alternative Kraftstoffen für Schiffe (PRL-AFS) zu erstellen. Das PRL-AFS ist ein Indikatorinstrument, das in neun Schritten die Fortschritte eines Hafens, der Hafenanlauf- oder Bunkerdienste anbietet, verfolgt, um schließlich bereit zu sein, Schiffe mit individuellen Kraftstoffen aufzunehmen.
„Zusätzlich zu dem Indikator haben wir eine praktische Visualisierung entwickelt, die den Status jedes Hafens für jeden alternativen Kraftstoff auf einen Blick zeigt – was unserer Meinung nach für Interessengruppen wie Schiffseigner/-betreiber, Regulierungsbehörden und Kraftstofflieferanten interessant ist. Die Visualisierungsmatrix bietet eine Vielzahl von Informationen auf einen Blick, darunter den aktuellen Bereitschaftsgrad für einen bestimmten Kraftstoff, die Ambitionen des Hafens und auch relevante Informationen über die Nutzung des Hafenraums“, sagt Namrata Nadkarni, Vorsitzende der Arbeitsgruppe und Gründerin der maritimen Beratungsfirma Intent Communications. „Darüber hinaus haben wir begonnen, Leitlinien für die Überlegungen auf jeder einzelnen Ebene zu entwickeln.“
Während die Zukunft dieser Arbeitsgruppe über das Jahr 2023 hinaus noch nicht feststeht, soll der Indikator in den kommenden Monaten verfeinert werden, um zu prüfen, ob er auch auf andere Hafentypen anwendbar ist, und um Rückmeldungen von relevanten Stakeholdern wie der IAPH, der International Chamber of Shipping, der Ghetto to Zero-Koalition und der International Association of Bunker Operators zu erhalten. Die Zusammenarbeit mit der IAPH ist auch ein Auftakt, um die IMO und andere Hafengemeinschaften auf Vorschläge aufmerksam zu machen. Die Arbeitsgruppe wird auch weiter an der Erstellung des Begleitdokuments für die PRL-AFS arbeiten, der nicht nur für Häfen von unschätzbarem Wert sein wird, sondern auch als pädagogisches Instrument zur Beantwortung der häufig gestellten Frage „Wann sind Sie bereit für alternative Kraftstoffe?“
Weitere Fortschritte werden im Herbst mit allen CEOs der Häfen erörtert, gefolgt von der ersten globalen WPCAP-Konferenz in der ersten Hälfte des Jahres 2023.
Quelle und Foto: Port of Rotterdam