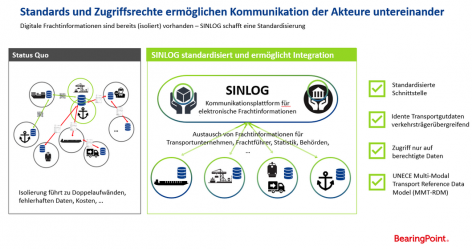Liebherr steigert Umsatz deutlich

Die Firmengruppe Liebherr hat im Jahr 2021 einen Umsatz von 11.639 Mio. € erzielt. Im Vergleich zum Vorjahr verzeichnete das Unternehmen somit insgesamt eine Steigerung um 1.298 Mio. € oder 12,6 %. Damit konnte die Firmengruppe beim Umsatz beinahe an ihr bisheriges Rekordjahr 2019 anknüpfen.
Zwar gestalteten sich die Rahmenbedingungen auch im abgelaufenen Geschäftsjahr für produzierende Unternehmen schwierig. Ab dem zweiten Quartal 2021 waren verschiedene Rohmaterialien, Komponenten und Elektronik-Bauteile zum Teil nur schwer zu beschaffen. Höhere Preise und Engpässe in den globalen Lieferketten waren die Folge. Trotzdem legte Liebherr beim Umsatz gegenüber dem Vorjahr deutlich zu. Die Firmengruppe wuchs in elf ihrer 13 Produktsegmente und in nahezu allen ihren Absatzregionen.
Der Umsatz in den Produktsegmenten Erdbewegungsmaschinen, Materialumschlagmaschinen, Spezialtiefbaumaschinen, Mobil- und Raupenkrane, Turmdrehkrane, Betontechnik und Mining betrug insgesamt 8.009 Mio. € und lag damit 17 % über dem Vorjahresniveau. Mit den Produktsegmenten Maritime Krane, Aerospace und Verkehrstechnik, Verzahntechnik und Automationssysteme, Kühl- und Gefriergeräte sowie Komponenten und Hotels erzielte Liebherr einen Gesamtumsatz von 3.630 Mio. €, was einem Zuwachs von 3,9 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.
Innerhalb der Europäischen Union, der für die Firmengruppe traditionell stärksten Absatzregion, konnte der Umsatz gesteigert werden. In fast allen EU-Märkten waren hohe Wachstumsraten zu verzeichnen, wobei sich insbesondere in Frankreich das Geschäft überdurchschnittlich entwickelt hat. Außerhalb der EU war unter anderem im Vereinigten Königreich eine deutliche Umsatzsteigerung zu verzeichnen. In Nordamerika sowie in Mittel- und Südamerika entwickelte sich Liebherr ebenfalls positiv, wobei ein starker Wachstumsimpuls vor allem aus Brasilien kam. Rückgänge verzeichnete die Firmengruppe in Afrika sowie im Nahen und Mittleren Osten, während das Geschäftsjahr in Asien und Ozeanien mit einem moderaten Plus abgeschlossen werden konnte.
Die Firmengruppe Liebherr erzielte 2021 ein Jahresergebnis von 545 Mio. € und damit einen Wert über dem Niveau vor der Pandemie. Betriebs- und Finanzergebnis haben im Vergleich zum Vorjahr deutlich zugenommen. Im Geschäftsjahr 2021 hat sich auch die Mitarbeiterzahl erhöht. Zum Jahresende beschäftigte die Firmengruppe Liebherr weltweit insgesamt 49.611 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 1.686 mehr als im Vorjahr.
Als Technologieunternehmen verfolgt die Firmengruppe das Ziel, den technologischen Fortschritt in den für Liebherr relevanten Branchen maßgeblich mitzugestalten. Im vergangenen Jahr investierte die Firmengruppe deshalb 559 Mio. € in Forschung und Entwicklung. Ein Großteil davon floss in die Entwicklung neuer Produkte. Zahlreiche Kooperationen mit Universitäten, Hochschulen und Forschungsinstituten wurden initiiert oder fortgesetzt.
Ein Schwerpunkt der Forschungsprojekte bei Liebherr sind weiterhin alternative Antriebstechnologien. Die Firmengruppe verfolgt einen technologieoffenen Ansatz und arbeitete in 2021 beispielsweise an wasserstoffgetriebenen Verbrennungsmotoren und deren Einspritztechnologien wie auch an elektrischen Antrieben. So erweiterte Liebherr sein Programm an Baumaschinen mit Elektroantrieben um zwei vollelektrische Fahrmischer auf Fünf-Achs-Fahrgestellen, die beiden Elektro-Raupenbagger R 976-E und R 980 SME-E und die batteriebetriebenen, lokal emissionsfreien Raupenkrane LR 1160.1 unplugged und LR 1130.1 unplugged. Mit dem Start der Entwicklungsphase des ersten vollelektrischen Offshore-Krans leitete Liebherr die Elektrifizierung des Produktportfolios in diesem Bereich ein. Überdies hat Liebherr verschiedene Produktlinien auf den Einsatz von hydrierten Pflanzenölen (HVO) als Treibstoff vorbereitet. Die Standorte Ehingen und Kirchdorf an der Iller (beide Deutschland) betanken bereits jetzt alle Maschinen standardmäßig ab Werk mit dem klimaneutralen Kraftstoff.
Zu den weiteren Entwicklungsschwerpunkten zählt die Digitalisierung. Unter anderem wurde eine neue Reihe von Kühl- und Gefriergeräten mit ressourcenschonenden Frischetechnologien und digitaler Vernetzung auf den Markt gebracht. Zudem wurden in mehreren Produktsegmenten die bestehenden Technologien zur Fernsteuerung, Automatisierung und Vernetzung optimiert sowie die Liebherr-Remote-Service-App erweitert. Hervorzuheben ist auch die Entwicklung zweier Assistenzsysteme für Mining-Trucks, die unter anderem eine automatische Lenkunterstützung bieten und die Belastung des Fahrers sowie den Kraftstoffverbrauch reduzieren.
Investitionen in Höhe von 742 Mio. € flossen in die Produktionsstätten und das weltweite Vertriebs- und Servicenetz. Die Investitionen erhöhten sich damit im Vergleich zum Vorjahr um 137 Mio. €. Dem stehen Abschreibungen in Höhe von 507 Mio. € gegenüber. Im Segment Betontechnik nahm eine neue Produktionsstätte ihren Betrieb auf: Die Liebherr-Concrete Technology Marica EOOD im bulgarischen Plovdiv versorgt die Liebherr-Mischtechnik GmbH in Bad Schussenried (Deutschland) mit Vormontagen für Fahrmischer und fertigt den Stahlbau dafür. Um die Präsenz auf dem asiatischen Markt weiter auszubauen und der hohen Nachfrage der Wind- und Baubranche Rechnung zu tragen, wurde mit der Errichtung eines neuen Werks für Komponenten in China begonnen. Die Liebherr Components (Dalian) Co., Ltd. soll ab Ende des Jahres 2022 Großwälzlager, Getriebe und Hydraulikzylinder am Standort Dalian produzieren. Eine neue Montagelinie für Getriebe entstand zudem in Indien. Darüber hinaus wurde für den Standort Ehingen (Deutschland) eine großflächige Werkserweiterung beschlossen. Bis 2030 wird dort schrittweise in den Ausbau investiert, um die Produktionskapazität deutlich zu erhöhen und die weiterhin steigende Nachfrage nach Mobil- und Raupenkranen zu bedienen.
Parallel dazu baute die Firmengruppe ihre Vertriebs- und Serviceinfrastruktur weiter aus. In Österreich sind neue Logistikzentren in Telfs und Bischofshofen entstanden und in Puch/Urstein begann die Errichtung einer neuen Vertriebszentrale für Baumaschinen. In Dettingen / Iller (Deutschland) erweiterte Liebherr die Vertriebs- und Serviceinfrastruktur für Baumaschinen durch ein neues Verwaltungs- und Reparaturgebäude. Darüber hinaus ist eine neue Hauptniederlassung für die Liebherr (China) Co., Ltd. in Shanghai entstanden und auch der Hauptsitz von Liebherr in Panama erfuhr eine signifikante Vergrößerung.
Die Firmengruppe Liebherr ist mit einer sehr guten Auftragslage in das Jahr 2022 gestartet. Chancen ergeben sich aus der erwarteten Erhöhung der Nachfrage in den verschiedenen Industriezweigen, in denen die Firmengruppe aktiv ist. Jedoch sind aufgrund des Krieges in der Ukraine negative Auswirkungen auf die Aktivitäten der Firmengruppe bereits jetzt festzustellen. Liebherr verfolgt und beurteilt täglich die aktuelle Situation in der Ukraine wie auch in Russland und ist derzeit dabei, die Russland-Aktivitäten auf die umfangreichen Sanktionen, die gegen das Land verhängt wurden, auszurichten. Gleichzeitig bestehen weiterhin Unsicherheiten durch die pandemiebedingten Einschränkungen, die Wirkungen der breiten Preissteigerungen bei vielen Gütern und Dienstleistungen, die Knappheit bestimmter Rohstoffe und den Fachkräftemangel sowie durch Engpässe in unterschiedlichen Lieferketten. Ebenfalls ist unklar, wie sich fiskal- und geldpolitische Maßnahmen letztlich auf die Firmengruppe Liebherr auswirken. Trotz der schwierigen Rahmenbedingungen blickt Liebherr verhalten optimistisch auf den weiteren Jahresverlauf.
Den Geschäftsbericht der Firmengruppe Liebherr gibt es hier.
Quelle und Grafik: Liebherr