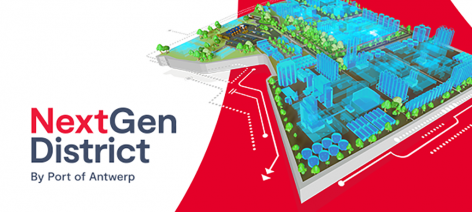Der Handel mit Kühlprodukten mit Hilfe von Kühlcontainern wächst im Rotterdamer Hafen spektakulär. Mit dem Ziel, diesen Wachstumsmarkt zu erschließen und gleichzeitig die Zollkontrollen schneller, effizienter und sicherer zu machen, haben sich Hafenbetrieb Rotterdam, Zoll, GroentenFruit Huis und Portbase zusammengeschlossen. Kühlcontainer machen mehr als 15 % der über den Rotterdamer Hafen verschifften Container aus. Es ist zu erwarten, dass dieser Anteil in den kommenden Jahren weiter steigen wird. Die ersten Ergebnisse der Zusammenarbeit sind vielversprechend.
Gemeinsam mit den Lieferkettenpartnern ist der Hafenbetrieb Rotterdam ständig auf der Suche nach Möglichkeiten, die Effizienz und Sicherheit der Hafen- und Kettenprozesse weiter zu optimieren. Vor kurzem wurde ein Pilotprojekt gestartet, das die Zollprozesse effizienter und sicherer machen soll. „Das ist noch immer ein recht komplizierter Prozess, der mehr beinhaltet, als man auf den ersten Blick vermuten würde“, eröffnet Hanna Stelzel, Business Manager Logistics and Supply Chain beim Hafenbetrieb Rotterdam. Was man im Volksmund als Zolltätigkeiten bezeichnet, umfasst in der Praxis mehr als nur die vom Zoll durchgeführten Tätigkeiten. Es ist ein Zusammenspiel zwischen Zoll, Frachtmaklern, Terminals, Reedereien und anderen beteiligten Kettenpartnern. Und dazu gehört eine Menge Kommunikation in allen Richtungen.
„Die Kommunikation zwischen allen Beteiligten bestimmt weitgehend die Effizienz des gesamten Inspektionsprozesses“, fügt Anne Saris, Business Manager Agrofood and Distribution beim Hafenbetrieb Rotterdam, hinzu. „Zusammenarbeit ist ausschlaggebend. Je schneller und reibungsloser die Kommunikation verläuft, desto effizienter ist die Zollabfertigung.“
Nicht umsonst war die wachsende Zahl der Kühlcontainer der Anlass, die Prozesse gemeinsam mit den Kettenpartnern unter die Lupe zu nehmen. Je mehr Container über den Hafen verschifft werden, desto mehr Inspektionen müssen durchgeführt werden.
Diese Inspektionen werden auf der Grundlage von Risikoanalysen und -profilen durchgeführt. Unter anderem bestimmen das Herkunftsland und die Vorgeschichte (oder gerade deren Fehlen), ob ein Container inspiziert wird oder nicht. Da Kühlcontainer häufig aus Hochrisikogebieten kommen, werden sie auch häufiger für eine solche Inspektion ausgewählt. Auch im Hinblick auf das erwartete weitere Wachstum ist es entscheidend, dass der Hafen optimal vorbereitet ist, um den zunehmenden Strom von Kühlcontainern zu ermöglichen. Effiziente Zollprozesse sind hierbei ein wesentliches Glied in der Kette. „Zudem tragen sie dazu bei, zusätzliche Ströme anzuziehen“, fügt Frau Stelzel hinzu.
Die Container können auf dreierlei Weise vom Zoll inspiziert werden. Die häufigste Variante ist das Scannen. Alle großen Containerterminals auf der Maasvlakte in Rotterdam verfügen über einen Hightech-Zollscan auf ihrem eigenen Gelände. Die Bilder des Containerinhalts werden vom Zoll rund um die Uhr per Fernanalyse ausgewertet. Das bedeutet, dass die Container das Gelände nicht verlassen müssen oder unnötig geöffnet werden müssen und in 95 % der Fälle innerhalb von 36 Stunden nach dem Entladen wieder freigegeben werden. Eine zweite Variante ist die physische Inspektion, kurz „fyco“ genannt, die im Rijks Inspectie Terminal (RIT) auf der Maasvlakte durchgeführt wird. Die dritte Variante ist der Einsatz von Spürhunden zur Kontrolle der jeweiligen Container an den Terminals. „Es kommt auch vor, dass die Scan-Bilder Anlass zu einer weiteren Überprüfung geben. Das ist dann eine „Fyco“ im RIT“, ergänzt Loekie Lepelaar, Beraterin Zollangelegenheiten und Kundenbetreuerin bei der Zollbehörde des Rotterdamer Hafens.
„Gemeinsam mit den Kettenpartnern nehmen wir ständig Prozesse unter die Lupe und analysieren wir die Engpässe“, fügt Frau Saris hinzu. Zur Minimierung von Wartezeiten und Verzögerungen bei Zollüberprüfungen wurde kürzlich ein Projektteam zusammengestellt, an dem neben dem Hafenbetrieb und dem Zoll auch Mitglieder von GroentenFruit Huis und Portbase teilnehmen. Das Projektteam analysierte die Zollprozesse und kam zu dem Schluss, dass es, insbesondere bei den physischen Kontrollen und den Überprüfungen mit Spürhunden, ein relativ großes Verbesserungspotenzial gibt. „Der sich daraus ergebende Nutzen liegt nicht so sehr in den Überprüfungen selbst, sondern vor allem in den Prozessen, die sie umgeben, wie z. B. die Disponierung von Transporten vom Terminal zum RIT und wieder zurück sowie die Kommunikation zwischen den Beteiligten“, erklärt Frau Stelzel.
Die weitere Analyse ergab auch, dass ein großer Teil der Engpässe die Folge von Prozessen ist, die noch eine oder mehrere manuelle Handlungen erfordern. Frau Stelzel: „Wenn ein Container vom Zoll für eine physische Kontrolle ausgewählt wird, wird dies dem Frachtmakler und dem Terminal mitgeteilt. Daraufhin beauftragt der Frachtmakler einen Logistikdienstleister mit dem Transport des Containers zum Rijks Inspectie Terminal. Dieser Transport wird dann für den nächsten Tag eingeplant. Bei manuellen Prozessen, wie handgeschriebenen E-Mails oder telefonischem Kontakt zwischen den beteiligten Kettenpartnern, kann es passieren, dass ein am Donnerstag gescannter Container erst am Montag oder gar Dienstag dem RIT übergeben wird, auch weil nicht alle Glieder der Kette rund um die Uhr arbeiten.“ Das ist alles andere als wünschenswert, besonders bei Kühlcontainern, bei denen die Haltbarkeit der Ware entscheidend ist“, sagt Frau Saris.
In diesem Frühjahr wurde deshalb ein Pilotprojekt gestartet, in dem manuelle Prozesse weitgehend digitalisiert werden. Alle Zollkontrollen werden bereits digital über das Inspectieportaal im Port Community System von Portbase angemeldet. „Indem wir diese Anmeldungen – mit Zustimmung der Frachtmakler – auch digital an den Frachtführer übermitteln, kann die Disponierung der Transporte beschleunigt werden. Besonders wenn ein Wochenende dazwischen liegt, kann die Zeitersparnis erheblich sein“, sagt Dalibor Stojakovic, Product Owner bei Portbase. Das bedeutet, dass der Frachtführer nicht mehr auf den Auftrag des Frachtmaklers warten muss, bevor er disponieren kann. Der eigentliche Transport erfolgt natürlich erst nach der Auftragserteilung.“
„Durch die weitere Digitalisierung werden die Durchlaufzeiten verkürzt und die Wartezeiten minimiert“, ergänzt Daco Sol. Der Programm-Manager Logistics, Supervision & Supply Chain bei GroentenFruit Huis kennt die Folgen von unerwünschten Verzögerungen besser als jeder andere. „Bei Frischware besteht die Gefahr von Qualitätsverlusten. Möglicherweise müssen andere Vertriebskanäle gesucht werden, und der finanzielle Schaden kann in die Zehntausende Euro gehen. Daran kann natürlich niemand Interesse haben. Die Minimierung von Warte- und Durchlaufzeiten war für uns einer der wichtigsten Gründe zur Teilnahme. Unsere Mitglieder importieren frische Produkte und bemühen sich um die kürzest mögliche Durchlaufzeit in der Kette.“
Es ist noch nicht bekannt, wie groß der Nutzen sein wird. „Wir befinden uns noch in der Startphase. Es ist zu früh, darüber mehr zu sagen. Deutlich jedoch ist, dass Digitalisierung die Prozesse effizienter macht“, sagt Frau Stenzel. Ihr zufolge ist es hilfreich, wenn alle Beteiligten das Potenzial sehen und tatsächlich bereit sind, Verbesserungen vorzunehmen.
Sol fügt hinzu: „Der größte Nutzen bisher ist, dass es viel mehr Einblick gibt. Wir wissen, wo Verzögerungen auftreten und dass der Engpass in der Kommunikation und in den manuellen Handlungen liegt. Die Aufmerksamkeit, die jetzt darauf gelenkt wird, ist ein erster Schritt in die richtige Richtung. Aber wir sind noch nicht am Ziel. Für uns ist das Ziel erst dann erreicht, wenn alle Prozesse, die logisch gestaltet und optimiert werden können, auch tatsächlich so gestaltet und optimiert sind. Das mag ehrgeizig klingen, doch ich bin davon überzeugt, dass es machbar ist, solange wir alle am selben Strang ziehen.“
Frau Stelzel schließt ab: „Die ersten Ergebnisse sind vielversprechend. Nicht nur für Kühlcontainer, sondern auch für die übrigen Container können Verzögerungen auf ein Minimum beschränkt werden. Ladungseigner werden dadurch nicht mit unnötigen Kosten belastet. Andere Kettenpartner haben inzwischen auch Interesse bekundet, und wir erwarten, auch in diesem Bereich schnell Schritte zu unternehmen. Letzten Endes ist es so, dass wir gemeinsam den Hafen effizienter machen.“
Quelle und Foto: Port of Rotterdam