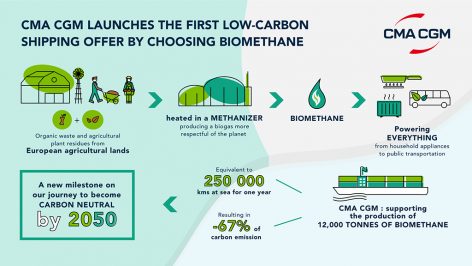Port of Antwerp erweitert Flotte

Port of Antwerp weihte jetzt drei neue RSD-Schlepper ein. Diese Erweiterung ist Teil der Erneuerung und Ökologisierung der Flotte mit dem Fokus auf nachhaltige und energieeffiziente Schiffe.
2020 liefen 14.000 Seeschiffe und 57.000 Binnenschiffe den Hafen von Antwerpen an. Um all diese Schiffe sicher und reibungslos von den Schleusen zu ihren Liegeplätzen und umgekehrt zu leiten, führt der Port of Antwerp jedes Jahr 19.000 Schleppvorgänge hinter den Schleusen durch, sowohl am rechten als auch am linken Ufer. Um all diese Schleppeinsätze erfolgreich abzuschließen, verfügt Port of Antwerp über 18 einsatzbereite Schlepper und 250 Kollegen, die 24/7/365 in Bereitschaft sind.

Im September 2020 erwarb Port of Antwerp den ersten RSD-Schlepper von Multraship NV, zwei weitere Schiffe folgten. RSD steht für Reversed Stern Drive und bedeutet, dass der Schlepper nach dem Doppelbugprinzip konstruiert ist. Dadurch kann er dynamisch als Bug- und Heckschlepper eingesetzt werden. Darüber hinaus ist der Schlepper dank seiner besonderen Konstruktion energieeffizienter und mit einem Stickoxidfilter ausgestattet, um die IMO-Stufe-III-Vorschriften zu erfüllen. Die neuen Schlepper sind eine Konstruktion des Schiffbauers Damen.
Um die Besatzung und das technische Personal auf die Ankunft dieser neuen Schiffe vorzubereiten, erhielten sie ein intensives, mehrmonatiges Training. Diese Ausbildung umfasste einen nautischen Teil, in dem es darum ging, das Navigieren mit Ruderpropellern zu erlernen, und einen technischen Teil, bei dem es um Kenntnisse der Schiffssysteme an Bord, Wartung und Fehlersuche ging. Diese intensive und nachhaltige Schulung wurde intern durchgeführt und extern von Multraship NV und Damen unterstützt.
Port of Antwerp betreibt eine Flotte von 32 Schiffen, bestehend aus Schleppern, Baggerschiffen und Hilfsschiffen. Diese Flotte ist für fast 85 % der gesamten CO2-Emissionen des Hafens von Antwerpen verantwortlich. Um diese Auswirkungen zu minimieren, wurde ein mehrjähriges Projekt zur Erneuerung, Ökologisierung und Optimierung der Flotte in die Wege geleitet. Neben der Anschaffung neuer Schlepper werden auch Daten zur Verbesserung von Prozessen geprüft. Zum Beispiel gemeinsam mit Partnern wie Optiport, die ein Tool zur Optimierung der Planung von Schleppeinsätzen entwickelt haben, und Cognauship, die am Verbrauch der eigenen Schlepper arbeiten werden.
Jacques Vandermeiren, CEO Port of Antwerp: „Der Kauf dieser Schiffe ist Teil der Erneuerung und Ökologisierung unserer Flotte, bei der wir uns auf nachhaltige und energieeffiziente Schiffe konzentrieren. Wir wollen bis 2050 klimaneutral sein, und dafür suchen wir nach alternativen Kraftstoffen wie Wasserstoff, Elektrizität und Methanol, zusätzlich zur Erneuerung mit nachhaltigen Schiffen mit konventionellen Kraftstoffen.“
Rob Smeets, Chief Operations Officer Port of Antwerp: „Die neuen Schlepper bieten eine schnelle Reaktionszeit, sodass unsere Kapitäne schneller auf die unterschiedlichen Bedingungen reagieren können. Außerdem sind die RSD-Schlepper viel leiser, ruhiger und es sind weniger Vibrationen an Bord zu spüren, was für die Besatzung sicherlich viel ausmacht.“
Hafenrätin Annick De Ridder: „Mit der Erweiterung unserer Flotte streben wir weiterhin nach 100-prozentiger Einsatzbereitschaft und wollen den Weg für eine nachhaltige Schifffahrt weiter ebnen. Als Port of Antwerp gehen wir mit gutem Beispiel voran, indem wir einen großen Schritt machen, um unsere eigenen Schlepper umweltfreundlicher zu machen. In naher Zukunft werden wir auch mit Schleppern experimentieren, die mit nachhaltigem Methanol und Wasserstoff betrieben werden.“
Quelle und Fotos: Port of Antwerp