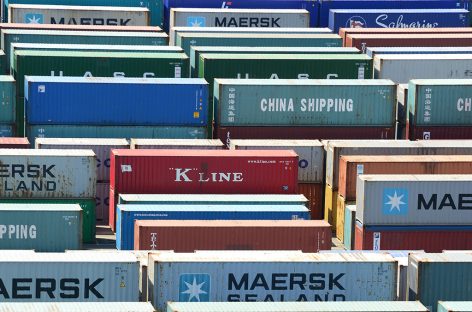Die Arbeiten an der Fahrrinnenanpassung der Unter- und Außenelbe gehen voran. Es geht dabei nicht nur um die Vertiefung und Verbreiterung der Fahrrinne für moderne Containerschiffe, sondern auch um die Durchführung der angeordneten Ausgleichsmaßnahmen für Natur und Umwelt. Auf dem Gebiet der WSV werden eine ganze Reihe von Maßnahmen durchgeführt.
Dr. Claudia Thormählen, Projektleiterin im WSA Hamburg: „Natürlich ist die Fahrrinnenanpassung auch ein Eingriff in die Natur. Wir setzen aber alles daran, diesen Eingriff durch Maßnahmen für die Natur zu kompensieren und sind dabei gut im Zeitplan!“
Die Planfeststellungsbehörden als Genehmigungsbehörden haben jüngst hierzu Ihren „5. Bericht (2020) zur Sicherung der Kohärenz des Netzes Natura 2000 im Zusammenhang mit der Fahrrinnenanpassung von Unter- und Außenelbe“ an die EU-Kommission abgegeben.
Zum einen die aquatische Kompensationsmaßnahme Schwarztonnensander Nebenelbe, bei der eine durchgängige Strömungsrinne hergestellt wurde. Damit werden bisher trockenfallende Gebiete wieder während des gesamten Tidezyklus überflutet. Die entstehenden hochwertigen Flachwasserbereiche werten das Biotop insgesamt auf. Zusätzlich wurde eine drei Fußballfelder große Uferschlenze angelegt.
Zum anderen fanden umfangreiche Bauarbeiten auf der Insel Schwarz-tonnensand, im Gebiet Allwördener Außendeich-Mitte und –Süd und an der Stör statt, mit denen der Tide-Auwald gestärkt wird und gute Lebens-bedingungen für Röhrichte und feuchte Hochstaudenfluren geschaffen werden, die wichtig für unterschiedliche Insekten und Vögel sind. Prielsysteme, Tidetümpel sowie aufgeweitete Grüppen wurden neu gestaltet und erhöhen den Tideeinfluss.
„Der Tisch ist gedeckt“ für die ungestörte Naturentwicklung: Pflanzen, Vögel und Fische werden die Nutznießer der neuen tidebeeinflussten Flächen sein.
Den Bericht 2020 gibt es hier. Auch die Berichte aus den Jahren 2012, 2014, 2016 und 2018 stehen unter dieser Adresse zum Download zur Verfügung.
Auf der Website www.fahrrinnenanpassung.de finden Sie zu allen Maßnahmen aktuelle Fotos, die wir Ihnen gern auf Anfrage in einer für den Druck geeigneten Auflösung zur Verfügung stellen.
Die Stellungnahme der EU-Kommission vom 6. Dezember 2011 verpflichtet die deutschen Behörden (= Planfeststellungsbehörden) dazu, im Zusammenhang mit der Fahrrinnenanpassung von Unter- und Außenelbe alle zwei Jahre einen Bericht an die EU-Kommission anzufertigen. Berichtet wird über die Durchführung und Überwachung der Ausgleichs- und Kohärenzsicherungs-maßnahmen, die in den Planfeststellungsbeschlüssen definiert worden sind.
Dies ist der Stand der einzelnen Kompensationsmaßnahmen im Zuständigkeitsbereich der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes:
Aquatische Kompensationsmaßnahme Schwarztonnensander Nebenelbe
In der Schwarztonnensander Nebenelbe wurde eine durchgängige Strömungsrinne hergestellt. Damit werden bisher trockenfallende Gebiete wieder während des gesamten Tidezyklus überflutet. Die entstehenden hochwertigen Flachwasserbereiche werten das Biotyp insgesamt auf.
In Niedersachsen gestalteten beauftragte Baufirmen am südlichen Ufer der Schwarztonnensander Nebenelbe eine Bucht mit Anschluss an den Flachwasserbereich der Nebenelbe. Sie ist ca. 19.300 m² groß. Das entspricht knapp drei Fußballfeldern. Diese Uferschlenze ist so gestaltet, dass sie dauerhaft unter Tideeinfluss steht und nie gänzlich trocken fällt. So entsteht ein neuer Lebensraum insbesondere für Kleinorganismen im Wasser und für Fische. Den entnommenen Boden (gut 50.000 m³) konnte der Deichverband Kehdingen-Oste für die Deichverstärkung in seinem Zuständigkeitsbereich nutzen.
Kompensationsmaßnahme Insel Schwarztonnensand
Auch hier fanden umfangreiche Arbeiten statt, um das Naturschutzgebiet weiter aufzuwerten. So wurden durch ein verändertes Geländerelief der Tide-Auwald gestärkt und gute Lebensbedingungen für Röhrichte und feuchte Hochstaudenfluren geschaffen, die wichtig für unterschiedliche Insekten und Vögel sind. Eine 10 Hektar große Uferfläche wurde als Offenbodenbereich gestaltet. Unter Offenboden versteht man nicht oder nur spärlich bewachsenen Boden. Durch Fräsen der Fläche wird der Boden in diesem Zustand gehalten. Diese Sandfläche ist ideal für Offenlandbrüter, wie z.B. Kiebitz, Austernfischer, Regenpfeifer und Seeschwalben. Die gebaggerten Böden aus den Mulden und dem Offenbodenbereich nutzte man, um eine Dünenlandschaft zu schaffen. Die Dünen sollen sich langfristig zu Graudünen entwickeln.
Kompensationsmaßnahmen Allwördener Außendeich-Mitte und -Süd
Die Bauarbeiten in den zwei Gebieten wurden bis Mitte November weitest-gehend abgeschlossen. Restarbeiten erfolgen im nächsten Jahr. Die neu geschaffenen Prielsysteme und Tidetümpel sowie die aufgeweiteten Grüppen erhöhen den Tideeinfluss auf den Flächen.
Die Erfolgskontrolle beginnt ein Jahr nach Bauabnahme. In Allwörden ist für März 2022 die Aufnahme der Vernässung (Luftbilder) und die Revier-kartierung von Wasservögeln (Avifauna) geplant. Im Mai und von Juli bis September 2022 wird die Vegetationsentwicklung überprüft und in den kommenden Jahren folgen weitere Untersuchungen (z. B. zur Fischfauna, Brut- und Schlupferfolg von Wiesenvögeln).
Kompensationsgebiete an der Stör
Auch in den sechs Maßnahmengebieten in Schleswig-Holstein an der Stör sind die baulichen Aktivitäten abgeschlossen – bis auf einige Restarbeiten auf der Fläche Siethfeld im nächsten Jahr. Alle Flächen erhielten einen besseren Tidezufluss, so dass in den Gebieten häufiger Wasser steht. In Bahrenfleth, Hodorf und Neuenkirchen entstanden durch entsprechende Ufergestaltung auch Bereiche, in denen der bedrohte Schierlings-Wasserfenchel wachsen kann. Er wurde in Bahrenfleth bereits angepflanzt, 2021 geschieht dies auch in Hodorf und Neuenkirchen.
Quelle: Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Hamburg, Foto: HHM / Michael Lindner