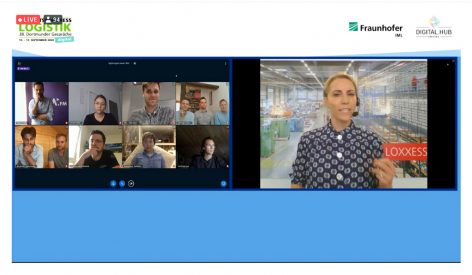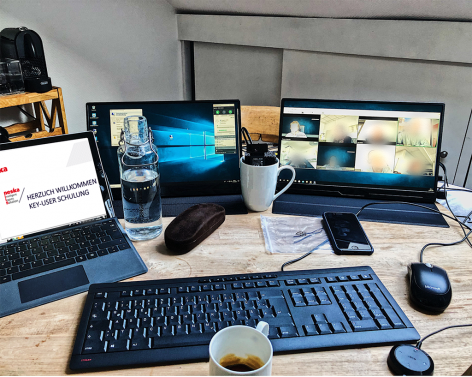Trends für die Zukunft der Logistik

In der fünften Ausgabe des Logistics Trend Radar stellt DHL 29 Schlüsseltrends vor, die die Logistikbranche in den nächsten Jahren beeinflussen werden. Der Bericht ist das Ergebnis einer umfassenden Analyse von Makro- und Mikrotrends und beruht auf Erkenntnissen aus einem großen Partnernetzwerk, das Forschungsinstitute, Technologie- unternehmen, Startups und Kunden umfasst.
„Damit wir unsere Kunden gut beraten können, ist es für uns als Logistikexperten wichtig, zukünftige Herausforderungen zu prognostizieren und mögliche Lösungen zu entwerfen. Die Megatrends, die uns weiterhin beschäftigen werden, sind uns bereits bekannt: neue Technologien, zunehmender E-Commerce und Nachhaltigkeit“, sagt Katja Busch, Chief Commercial Officer bei DHL. „Manche Bereiche werden sich jedoch schneller entwickeln als andere. Daher müssen wir die zugrunde liegenden Trends und ihre Auswirkungen auf die Logistik verstehen – nicht zuletzt wegen der Auswirkungen von COVID-19 auf den globalen Handel und die Bevölkerung. Als weltweiter Branchenführer in der Logistik haben wir die nötigen Einblicke und die Expertise, um die Situation zu beurteilen.“
In den vergangenen zwei Jahren haben weit über 20.000 Logistik- und Technologieexperten bei Besuchen im DHL Innovation Center ihre Perspektiven für die Zukunft der Branche vorgestellt. Diese Erkenntnisse werden im Logistics Trend Radar gebündelt. Das dynamische und strategische Tool wirft einen Blick in die Zukunft. Es verfolgt Entwicklungen, die in früheren Auflagen aufgezeigt wurden, und stellt in jeder Neuauflage vielversprechende neue Trends vor.
„Die nächste große Herausforderung wird es sein, das Logistikpersonal durch Aus- und Weiterbildung in technologisch immer anspruchsvolleren Betrieben zukunftssicher zu machen. Dies wird in den kommenden Jahren im Mittelpunkt der strategischen Planung von Supply-Chain- Organisationen stehen“, sagt Matthias Heutger, Senior Vice President, Global Head of Innovation & Commercial Development bei DHL. „Der Logistics Trend Radar ist ein Seismograph für zukünftige Trends. Auf der Grundlage der Daten der letzten sieben Jahre können wir längerfristige Prognosen erstellen und so unsere Partner und Kunden bei der Erstellung von Roadmaps für ihre Unternehmen unterstützen. Außerdem können wir dabei helfen, weitere branchenführende Forschungen und Innovationen zu strukturieren und auf den Weg zu bringen. In dieser Ausgabe berichten wir, wie Auswirkungen von COVID-19 bereits etablierte Trends beschleunigen. Big Data Analytics, Robotertechnik und Automatisierung sowie das Internet der Dinge (IoT) werden außerdem durch stetige Fortschritte in der künstlichen Intelligenz vorangetrieben.
Die fünfte Ausgabe des Logistics Trend Radar zeigt insgesamt eine Stabilisierung der Trends der letzten vier Jahre. Mit der Bewältigung der aktuellen globalen Pandemie durch die Logistikbranche haben sich die Transformationsprozesse jedoch beschleunigt. COVID-19 hat Innovationen in der Logistik, Automatisierung und digitale Arbeit schneller vorangetrieben und die Digitalisierung der Branche um Jahre beschleunigt. Umgekehrt haben viele Trends, die in der Logistikbranche zunächst als disruptiv galten, sich bislang als gar nicht so disruptiv erwiesen. Autonome Fahrzeuge und Drohnen werden nach wie vor durch gesetzgeberische und technische Herausforderungen sowie durch die geringe gesellschaftliche Akzeptanz gebremst. Die Logistikmarktplätze konzentrieren sich auf einigen wenigen führenden Plattformen. Etablierte Spediteure mit soliden globalen Logistiknetzwerken treten mit eigenen digitalen Angeboten auf den Plan. Von Cloud Computing bis hin zu kollaborativen Robotern, Big Data Analytics, künstlicher Intelligenz und dem Internet der Dinge – Logistiker müssen ein riesiges Spektrum an neuen Technologien zu nutzen wissen. Um heute langfristig Erfolg zu haben, müssen zwingend sämtliche Touchpoints der Lieferketten modernisiert werden. Dies reicht von eleganten digitalen Lösungen für die Kundenerfahrung über den Fulfillment-Transport bis hin zur Lieferung auf der letzten Meile. Anbieter, die sich am schnellsten anpassen, neue Technologien skalieren und ihre Arbeitskräfte qualifizieren, werden einen Wettbewerbsvorteil auf dem Markt haben.
Der E-Commerce nimmt weiter rasant zu, dennoch entfällt auf ihn nur ein Bruchteil der globalen Konsumausgaben. Für den Business-to-Business E-Commerce wird eine ähnliche Entwicklung erwartet. Man geht davon aus, dass sein Volumen drei Mal so groß sein wird wie das des Verbrauchermarkts. Die Coronavirus-Pandemie hat nicht nur das Wachstum des Onlinehandels und Innovationen in der Lieferkette beschleunigt. Entscheidungen über die Skalierung und Einführung neuer Technologien – wie intelligente physische Automatisierung, IoT-gestützte Transparenz-Tools und Prognosefähigkeit durch KI – werden letztlich dafür ausschlaggebend sein, ob Unternehmen die gestiegenen Kundenanforderungen erfüllen und in der Zukunft die Branchenführerschaft sichern können.
Regierungen, Städte und Logistiker verpflichten sich zur Senkung ihrer CO2-Emissionen und Abfälle, und Nachhaltigkeit wird ein Muss für alle Akteure der Logistikbranche. Angesichts der steigenden Nachfrage nach nachhaltigen Lösungen zur Abfallreduzierung, zur Nutzung neuer Antriebstechniken und zur Optimierung von Anlagen ist Nachhaltigkeit auch für die Lieferketten von entscheidender Bedeutung. Heute gibt es mehr als 90 nationale Verbote für Einweg- plastikartikel. Sperrige Verpackungen führen zu 40 Prozent Leerraum in Paketen. Ein Umdenken ist daher unumgänglich. Nachhaltige Lösungen in der Logistik – Optimierung von Prozessen, Materialien, neue Antriebstechniken und intelligente Einrichtungen – bieten ein enormes Potenzial, um die Branche umweltfreundlicher zu machen. Intelligente Containerlösungen werden ebenfalls eine wichtige Rolle spielen, um umweltschonende Konzepte für die Zustellung in verkehrsbelasteten Städten zu entwickeln.
DHL veröffentlicht den Logistics Trend Radar regelmäßig und stellt der globalen Logistikbranche damit ein wichtiges Instrument zur Verfügung. Bei DHL und in der gesamten Branche gilt er als Richtwert für Strategie und Innovation und ist ein wichtiges Tool, um die Richtung spezifischer Trends zu bestimmen – zuletzt waren dies Verpackungslösungen, 5G, Robotertechnik und digitale Zwillinge.
Die fünfte Ausgabe des DHL Logistics Trend Radar, einschließlich ausführlicher Analysen und Informationen zu Projekten, steht unter folgendem Link in englischer Sprache zum kostenlosen Download bereit: www.dhl.com/trendradar
Quelle und Grafik: Deutsche Post DHL Group