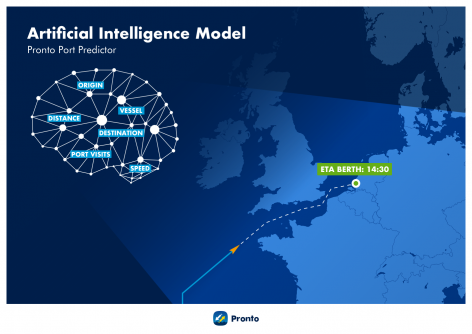Die JRF-Institute RIF und DST entwickeln ein neues Transportkonzept auf Basis von kleinen, elektrisch angetriebenen Schiffen, die in „Schwärmen“ neue dezentrale Märkte bedienen.
„Freie Fahrt auf den Autobahnen des Ruhrgebiets: Statt LKW-Kolonnen auf rechten Spuren sind jetzt Schwärme kleiner Schiffe auf den Kanälen der Region unterwegs. Emissionsfrei und leise bringen sie Container mit Waren aller Art zu kleinen automatisierten Umschlagplätzen und Stadthäfen der Metropole Ruhr.“ Was wie eine ferne Utopie klingt, steht kurz vor der Realisierung – zumindest virtuell. Zwei Johannes-Rau-Forschungsinstitute haben soeben damit begonnen, anhand der realen Daten der Güterströme im Ruhrgebiet und der verfügbaren technologischen Innovationen aus Schifffahrt, Logistik, Fahrzeugindustrie und Automatisierungstechnik ein alternatives Güterverkehrssystem zu entwerfen und entwickeln. Dabei entlastet eine dezentrale Binnenschifffahrt die Verkehrsträger Straße und Schiene massiv. Bis 2021 werden das DST Entwicklungszentrum für Schiffstechnik und Transportsysteme, Duisburg, und das RIF Institut für Forschung und Transfer, Dortmund, nun ein virtuelles Testbed aufbauen, in dem die Innovationen gemeinsam getestet werden können. Mitte September hat die EU die Finanzierung für das Forschungsprojekt namens „DeConTrans“ bewilligt, denn die Forscher rechnen damit, dass eine moderne Schwarm-Binnenschifffahrt kostengünstiger, umweltfreundlicher und effizienter als der LKW-Verkehr auf der Straße sein kann.
Das Ruhrgebiet liegt für beide Forschungspartner vor der Haustür. Als Anwendungsfall für eine innovative, dezentrale Binnenschifffahrt bietet es sich mit seinen vielen Wasserstraßen und kleinen Häfen, die noch aus der Montanära stammen, geradezu an. Zudem erhöhen aktuelle Verkehrsprobleme – Staus, Emissionen, gesperrte Rheinbrücken und schleppender Schienenausbau – den Problemdruck. Daher sehen DST und RIF hier gute Realisierungschancen für eine grundlegende Systeminnovation, die „Made in NRW“ gute Chancen für weitere Entwicklungen bietet.
„Binnenschiffe benötigen 60% weniger Energie beim Warentransport als der LKW und derzeit sind kleine Häfen und Kanäle im Ruhrgebiet kaum ausgelastet. Während bisher zumeist auf die Entwicklung großer Schiffe fokussiert wurde, könnten neuen Technologien für eine Sprunginnovation sorgen. Saubere Antriebe für kleine standardisierte Schiffe auf Basis elektrischer Energie und eine Automatisierung vieler Prozesse im Betrieb, von Festmachsystemen, über Krananlagen bis zum autonomen Fahren in intelligent integrierten Transportsystemen sind in der Entwicklung. Die beteiligten Komponenten sind gut bekannt, aber ihr Zusammenspiel ist äußerst komplex. Die Zusammenarbeit mit RIF bringt hier einen entscheidenden Schub für die Weiterentwicklung des Gesamtsystems“, sagt Dr.-Ing. Rupert Henn, DST-Vorstand.
„Die Optimierungspotenziale der Binnenschifffahrt für den Güterverkehr können nur dann genutzt werden, wenn die wichtigen Innovationen gleichzeitig und aufeinander abgestimmt umgesetzt werden. Diese Entwicklung ist komplex, für einzelne Akteure am Markt mit Risiken verbunden und daher durchaus mit einer Weltraummission vergleichbar, für die unsere virtuellen Testbeds ursprünglich entwickelt wurden. Wir freuen uns, dass wir mit den Daten aus der Realität nun für die Situation im Ruhrgebiet eine gemeinsame Entwicklungsumgebung aufbauen können, in der jede einzelne Komponente und ihre Wirkung im System schnell und kostengünstig getestet und vor allem auch mit Methoden des Maschinellen Lernens optimiert werden kann,“ sagt Prof. Dr. Jürgen Roßmann, RIF-Vorstand.
Bis Ende 2021 arbeiten 8 Mitarbeiter in den beiden Johannes-Rau Instituten nun daran, die komplette Logistikkette von der Umladung im Hafen auf die kleinen Schiffe bis zur Verladung für die letzte Meile an regionalen Umschlagstellen realistisch in einer virtuellen Plattform abzubilden, so dass unterschiedliche Logistikketten, variable Schiffstypen und verschieden konzipierte Umschlagplätze miteinander verglichen werden können. Schon während der Projektlaufzeit werden Reedereien, Spediteure, Verlader, Gewerbeverbände, Hafenbetreiber, Politik und Verwaltung auf allen Ebenen mit einbezogen.
„Das Projekt kann nicht nur zu einer nachhaltigen, umweltverträglichen und gesellschaftlich akzeptierten Mobilität beitragen. Es nutzt auch vorbildlich die Kompetenz am Forschungsstandort NRW. Für den Wirtschaftsstandort NRW hat das Vorhaben als technologische Innovationsplattform zudem eine Schlüsselrolle“, sagt Michael Saal, Geschäftsführer des RIF.
Weitere Informationen sind in Kürze auf der Internetseite des DST zu lesen.
Das EU-Projekt DeConTrans (EFRE-0801222/ML-2-1-010B) ist über drei Jahre geplant und soll bis Ende 2021 abgeschlossen werden.
Dieses Vorhaben wird gefördert aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) sowie aus Mitteln des Landes Nordrhein-Westfalen.
Das DST ist ein international tätiges Forschungsinstitut mit über 60-jähriger Erfahrung in den Bereichen Binnen- und Küstenschifffahrt sowie Transportsysteme. Ein Tätigkeitsschwerpunkt des DST liegt in der Untersuchung der speziellen Strömungsprobleme von Schiffen in Binnen- und Küstengewässern und in der Unterstützung des Gewerbes bei der Entwicklung und Modernisierung von Schiffen. Daneben werden Wellen- und Strömungskraftwerke untersucht und viele andere Sonderprojekte bearbeitet. Weiterhin stehen verkehrstechnische, -wirtschaftliche und -logistische Fragestellungen im Fokus mit der Zielsetzung, neue Potenziale für die Binnenschifffahrt zu erschließen und so zu einer wirtschaftlichen und umweltverträglichen Bewältigung der wachsenden Verkehrsnachfrage beizutragen.
Das DST betreibt seit 2008 den Schiffsführungssimulator SANDRA. Der Flachwassersimulator wurde speziell für die Schulung und Weiterbildung von Binnenschiffern und für die Bearbeitung flachwasserbezogener Projekte entwickelt. Ergänzend zu Modellversuchen im Schlepptank lassen sich auf diese Weise z.B. das Fahr- und Manövrierverhalten vom Binnenschiff bis hin zum Großcontainerschiff in der Binnen- und Revierfahrt bzw. neue Propulsions- und Steuerorgane am Simulator überprüfen.
Die enge Kooperation mit Industrie und Verwaltung gewährleistet einen zügigen Transfer der Ergebnisse der anwendungsorientierten Forschungs- und Entwicklungsarbeiten in die Praxis. Seit 1989 ist das DST An-Institut der Universität Duisburg-Essen und seit 2014 Mitglied der Johannes-Rau-Forschungsgemeinschaft.
Weitere Informationen: http://www.dst-org.de/
Das RIF Institut für Forschung und Transfer, Dortmund, wurde 1990 als Zusammenschluss von Hochschullehrern aus verschiedenen technologieorientierten Universitätsbereichen als „Dortmunder Initiative zur rechnerintegrierten Fertigung (RIF e.V.)“ zur Stimulierung des Forschungstransfers gegründet. Als eines der Johannes-Rau-Forschungsinstitute des Landes Nordrhein-Westfalen entwickelt RIF Erkenntnisse aus der Grundlagenforschung in Projekten interdisziplinär und anwendungsorientiert so weiter, dass sie von Unternehmen in der Praxis genutzt werden können. RIF setzt im Bereich Robotertechnik neueste Forschungserkenntnisse in der Simulation und Virtual Reality Technologie unmittelbar in Produkte um. Erkenntnisse aus der Mikrostrukturtechnik, Werkstofftechnologie und –prüfung unterstützen die Verbesserung und nachhaltige Gestaltung von Produkten. Innovative Werkzeuge aus dem Qualitätsmanagement, der Arbeitswissenschaft und der Logistik sowie automatisierungstechnische Lösungen helfen Unternehmen in den verschiedensten Branchen, ihre Produktivität und die Qualität von Produkten zu steigern bzw. Herstellungskosten zu senken. Der ganzheitliche Ansatz des Instituts wird durch Projekte im industriellen Marketing, durch innovative Controlling Konzepte und moderne Methoden der Personalentwicklung sowie des Veränderungsmanagements abgerundet. Über die Konrad Zuse-Forschungsgemeinschaft ist RIF zudem in ein bundesweites, branchenübergreifendes Netzwerk von über 60 deutschen außeruniversitären, gemeinnützigen Forschungseinrichtungen eingebunden. RIF beschäftigt im F+E Gebäude an der Joseph-von-Fraunhofer-Straße 20 im Technologiepark Dortmund rund 130 Mitarbeiter. Vorstand: Prof. Dr. Hartmut Holzmüller, Prof. Dr.-Ing. Jürgen Roßmann, Prof. Dr.-Ing. Wolfgang Tillmann, Geschäftsführer: Dipl.-Inf. Michael Saal.
Weitere Informationen: http://www.rif-ev.de/
Quelle und Grafik: DST/ RIF