Marktbeobachtung der Binnenschifffahrt in Europa: Ausgabe 2022
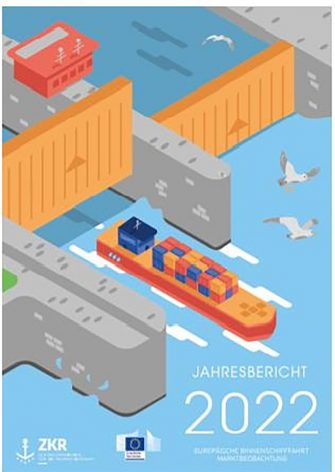
In Fortsetzung ihrer langen und fruchtbaren Zusammenarbeit mit der Europäischen Kommission freut sich die Zentralkommission für die Rheinschifffahrt (ZKR), ihren Jahresbericht der Marktbeobachtung der Binnenschifffahrt in Europa für 2022 vorzustellen.
Die Veröffentlichung des Jahresberichts der Marktbeobachtung der Binnenschifffahrt in Europa ist ein Beispiel für eine gelungene Zusammenarbeit auf europäischer Ebene, bei der alle Akteure und beteiligten Interessenvertreter, einschließlich der Flusskommissionen und der Vertreter des Gewerbes, eingebunden werden. Herr Smit, Generalsekretär des European Shippers’ Council (ESC), und Frau Luijten, Generalsekretärin der ZKR, veranschaulichen mit ihren Vorworten die dezidiert europäische Dimension der Veröffentlichung.
Der neue Jahresbericht gibt einen ausführlichen Überblick über die Marktlage und die Entwicklungen der Binnenschifffahrt in Europa im Jahr 2021.
Nachstehend finden Sie die Zusammenfassung dieses Berichts. Die vollständige Version kann als PDF Datei auf Französisch, Deutsch, Niederländisch oder Englisch heruntergeladen werden oder direkt online eingesehen werden unter: www.inlandnavigation-market.org.
Kurzfassung
Das Jahr 2021 war durch eine robuste Erholung gekennzeichnet, die dazu führte, dass die verschiedenen Gütersegmente der Binnenschifffahrt das Umschlag- und Beförderungsniveau vor der Pandemie erreichten und manchmal sogar übertrafen. Im Zuge der wirtschaftlichen Erholung stiegen die Rohstoffpreise bereits in der zweiten Jahreshälfte an. Die rasch steigende Nachfrage führte jedoch auch zu Störungen im Handel mit industriellen Komponenten.
Der wirtschaftliche Aufschwung war besonders ausgeprägt für den Güterverkehr in der Binnenschifffahrt, der 2021 im Vergleich zu 2020 in fast allen Marktsegmenten ein Wachstum verzeichnete. Die Güterbeförderung auf dem traditionellen Rhein nahm um 5,4% zu, blieb aber um 3,2% niedriger als 2019. Auch die Verkehrsleistung nahm 2021 gegenüber 2020 um 4,5% zu, erreichte aber nicht den Wert vor der Pandemie.
Die gestiegene Stahlproduktion und die hohen Gaspreise führten zu einem starken Anstieg der Kohlenachfrage und damit auch des Kohletransports auf dem Rhein, der im Jahr 2021 um 28,5% zunahm. Der Anstieg des Kohletransports auf dem Rhein entsprach dem Anstieg des Seeverkehrs bei der Kohle. Der Amsterdamer Hafen ist ein deutliches Beispiel für diesen Trend, da der seeseitige Umschlag von Kohle im Jahr 2021 um 41% anstieg. Die Beförderung von Eisenerz und Metallen nahm aufgrund der Erholung der Stahlproduktion kontinuierlich um 15,7% bzw. 11,2% zu. Andere Gütersegmente, nämlich Container, Agrargüter und Lebensmittel, Sande, Steine und Kies sowie Mineralölprodukte und Chemikalien, blieben einigermaßen stabil.
Der im Jahr 2021 verzeichnete wirtschaftliche Aufschwung lässt sich gut an der Entwicklung des Güterumschlags in den wichtigsten europäischen Seehäfen ablesen. Mit Ausnahme des Hamburger Hafens, der einen starken Rückgang des Binnenschiffsverkehrs verzeichnete (-16%), wurde in den wichtigsten europäischen Seehäfen ein Anstieg beobachtet, (+6% für den Hafen von Rotterdam, +9,7% für den Hafen von Constanţa, +9% für den Nordseehafen, +7,5% für den Hafen von Antwerpen).
Insgesamt wurde die Erholung des Güterverkehrs durch die Wasserstandsverhältnisse verstärkt. Auf dem Rhein war die Zahl der kritischen Niedrigwassertage im Jahr 2021 begrenzt. So lag beispielsweise am Pegel Kaub am Mittelrhein die Anzahl der Tage unter einem kritischen Niedrigwasserstand (gleichwertiger Wasserstand) im Jahr 2021 bei 10, im Vergleich zu 107 im Niedrigwasserjahr 2018. Die Analyse der Wasserstandsdaten für die Donau zeigt eine etwas höhere Anzahl von Niedrigwassertagen im Jahr 2021 und auch im Zeitraum von 2015 bis 2021.
Obwohl die Wasserführung insgesamt eher günstig war, wurden die Bedingungen gegen Ende des Jahres schlechter (4. Quartal 2021). Dieser Rückgang der Wasserstände führte im 4. Quartal 2021 zu einem Anstieg der Beförderungspreise bzw. Frachtraten, insbesondere für Trockengüter, die auf dem Spotmarkt angeboten werden. Die Frachtraten für Flüssiggüter wiesen in den letzten beiden Jahren einen leicht negativen Trend auf, der nur in Q4 2021 aufgrund des niedrigen Wasserstandes unterbrochen wurde. Die Gründe für den eher negativen Trend lagen in der geringeren Transportnachfrage nach Flüssiggütern aufgrund der Covid-Pandemie.
Für den Güterverkehr sind die Aussichten insgesamt auf eine Erholung für 2022-2024 ausgerichtet. Es bestehen jedoch erhebliche Abwärtsrisiken, die sich aus dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine und seinen Auswirkungen auf die Wirtschaft ergeben. Diese wirtschaftlichen Auswirkungen bestehen hauptsächlich in höheren Rohstoffpreisen und Versorgungsunterbrechungen.
Es wird erwartet, dass der Krieg in der Ukraine den Getreidetransport beeinträchtigen wird, da dieser Krieg zu starken Engpässen bei der Getreideausfuhr aus der Schwarzmeerregion in viele Getreideverbrauchermärkte geführt hat. Daher gewinnen alternative Getreideexportregionen an Bedeutung. Es ist zu erwarten, dass die Ernteregionen in Frankreich und der damit verbundene Hinterlandverkehr auf den französischen Wasserstraßen von dieser Situation profitieren werden. Der Fluss-See-Hafen von Rouen ist ein wichtiger Knotenpunkt für den Getreideexport, und die Binnenschiffe im Hinterland transportieren Getreide zum Hafen. Mit der Wiederbelebung des Handels zwischen dem Hafen von Rouen und den Ländern Nordafrikas dürfte die Binnenschifffahrt in Nordfrankreich von der Getreidebeförderung profitieren. Die nordafrikanischen Länder sind große Importeure von Getreide und müssen ihre Getreidevorräte sichern.
Im Jahr 2021 umfasste die Zahl der Binnenschiffe in Europa mehr als 10.000 in den Rheinstaaten registrierte Schiffe, 3.500 in den Donaustaaten und 2.300 in anderen europäischen Ländern. Die Neubaurate für Trockengüterschiffe sank um acht Einheiten, von 26 im Jahr 2020 auf 18 im Jahr 2021. Die Zahl der neu gebauten Tankschiffe stieg um 4 Einheiten, von 40 Einheiten im Jahr 2019 auf 54 im Jahr 2020 und 58 im Jahr 2021. Der Großteil der neuen Flüssiggüterschiffe ist für die Kapazitätskategorien 3.000-4.000 Tonnen und 2.000-3.000 Tonnen bestimmt.
Die Entwicklung der Beschäftigung im Güter- und Passagierverkehr im Binnenschifffahrtssektor in Europa zeigt von 2019 bis 2020 ein verändertes Muster. Die Folgen der Pandemie waren für den Passagierverkehr besonders schwerwiegend. So zeigen die Berichte für diese Kategorie eine steigende Tendenz von 17.895 Beschäftigten im Jahr 2010 auf 23.100 im Jahr 2019, während die Beschäftigung im Jahr 2020 auf 21.023 Beschäftigte zurückging. Die Zahl der Beschäftigten in der Güterbeförderung lag mit 23.170 Personen leicht über der Beschäftigung im Passagierverkehr.
Die Maßnahmen zur Eindämmung des Virus während der Pandemie haben den Passagierverkehr in den Jahren 2020 und 2021 stark beeinträchtigt. Auch wenn im Jahr 2021 aufgrund der Lockerung der Präventionsmaßnahmen eine Erholung bei den Bewegungen von Kreuzfahrtschiffen zu beobachten ist, liegen diese auf dem Rhein immer noch 55% unter dem Niveau vor der Pandemie im Jahr 2019.
Die Zahl der Durchfahrten von Kreuzfahrtschiffen an der Rheinschleuse Iffezheim stieg von 534 im Jahr 2020 auf 1.315 im Jahr 2021, blieb damit aber weit unter den 2.929 Durchfahrten des Jahres 2019. Vergleichbare Trends sind für die Donau und die Mosel zu verzeichnen. Auf der Donau an der deutsch-österreichischen Grenze stiegen die Zahlen von 324 Kreuzfahrtschiffen auf 1.255, auch wenn sie immer noch unter den 3.668 im Jahr 2019 liegen. Auf der Mosel sank die Zahl der Durchfahrten zwischen 2019 und 2020 von 1.536 auf 469, stieg aber im Jahr 2021 auf 1.000 an. Nicht nur die Schiffsbewegungen erreichten nicht mehr das Niveau vor der Pandemie, auch die Auslastung der Schiffe lag weit unter den für das Jahr 2019 bekannten Werten.
Auch wenn sich der Markt für Flusskreuzfahrten zu erholen scheint, könnten der anhaltende Krieg in der Ukraine und die gestiegenen Preise für Rohstoffe wie Stahl, die für den Bau neuer Schiffe erforderlich sind, die Aussichten für den Passagierverkehr im Jahr 2022 beeinträchtigen.
Viele Länder haben im Frühjahr 2022 ihre Grenzen für Reisende geöffnet, und es werden wieder neue Aufträge für Flusskreuzfahrtschiffe erteilt. Dennoch verursacht der Krieg in der Ukraine einige Schwierigkeiten für den europäischen Flusskreuzfahrtmarkt. Erstens könnte die Attraktivität der unteren Donau aufgrund des potenziellen Risikos von Fahrten in diesem Gebiet deutlich sinken. Zweitens könnte die Passagiernachfrage auch auf anderen europäischen Flüssen beeinträchtigt werden. Der Grund dafür ist, dass US-amerikanische Touristen den Krieg in der Ukraine als ein Phänomen wahrnehmen werden, das mit Europa im Allgemeinen verbunden ist. Außerdem hat der Krieg zu einem erheblichen Rückgang des ukrainischen Personals geführt, das auf dem Flusskreuzfahrtmarkt tätig ist. Schließlich kann der Anstieg der Treibstoffpreise zu Aufschlägen auf die Reisepreise führen, was sich ebenfalls auf den Tourismus auswirkt.
Quelle und Grafik: ZKR Zentralkommission für die Rheinschifffahrt








