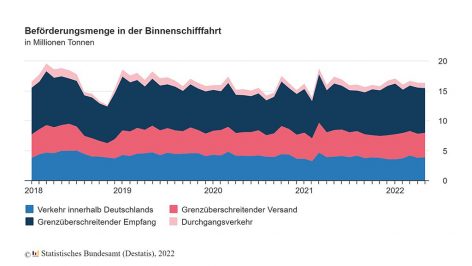Das ausgeprägte Niedrigwasser in den Monaten Juli und August in Verbindung mit der hohen Nachfrage nach Binnenschiffstransporten aufgrund der Energieknappheit oder der enttäuschende Haushaltsbeschluss der Ampel-Koalition für Unterhalt und Ausbau der Wasserstraßen: Die Entwicklungen in den vergangenen Monaten haben den Bundesverband der Deutschen Binnenschifffahrt e.V. (BDB) dazu veranlasst, unter dem Titel „Versorgung von Wirtschaft und Verbrauchern per Binnenschiff in Krisenzeiten“ einen Parlamentarischen Abend der Binnenschifffahrt in Berlin auszurichten.
Gemeinsam mit Dr. Paul Seger, Schweizerischer Botschafter der Bundesrepublik Deutschland in Berlin, lud der BDB am Abend des 1. Dezember Vertreter aus Politik, Verwaltung, dem Schifffahrtsgewerbe und der verladenden Industrie zu einer angeregten Diskussion in die Schweizer Botschaft ein.
BDB-Präsident Martin Staats (MSG) kritisierte in seiner Rede deutlich die Entscheidung der Ampel-Koalitionäre, den Haushaltsetat für die Bundeswasserstraßen im Jahr 2023, um rund 350 Mio. Euro zu kürzen. Die Möglichkeit, dass bis Juni 2023 maximal 250 Mio. Euro zusätzlich für die Wasserstraßen angemeldet werden können, sofern diese Mittel bei anderen Verkehrsträgern eingespart werden, werte diesen Beschluss aus Sicht des Gewerbes nicht auf: „Was für andere die sogenannte ‚Bazooka‘ oder der ‚Doppelwumms‘ war, hat sich für uns leider nur als ‚Knallfrosch‘ erwiesen“, so Staats. Dabei habe das Binnenschifffahrtsgewerbe seine immense Bedeutung für die Versorgungssicherheit in vielerlei Hinsicht unter Beweis gestellt, auch im Hinblick auf die „solidarity lanes“ der EU. So habe das Gewerbe dafür gesorgt, dass auch seit Kriegsbeginn in der Ukraine Getreidetransporte über die Donau im osteuropäischen Raum aufrechterhalten wurden – nicht ohne Folgen für das westeuropäische Geschäft: „Es sind viele Kapazitäten an Schiffsraum nach Osteuropa verkauft worden, und wir wissen nicht ob und wann diese wieder zurückkehren“, so Staats.
Die Vertreter der verladenden Wirtschaft bestätigten deutlich die Bedeutung und Systemrelevanz des Binnenschiffs für die Versorgungssicherheit der Industriestandorte und der Bevölkerung. Wenn der „nasse Verkehrsträger“ infolge signifikanter Niedrigwasserereignisse und aufgrund der bestehenden Engpässe im Wasserstraßennetz eingeschränkt sei, bedrohe dies die Stahlindustrie und auch den Transformationsprozess hin zu mehr Klimafreundlichkeit, erklärte Markus Micken (Thyssenkrupp Steel Europe AG) im Rahmen der Podiumsdiskussion mit den Bundestagsabgeordneten MdB Jürgen Lenders (FDP), Mitglied im Verkehrsausschuss des Bundestages, MdB Henning Rehbaum (CDU), Sprecher der Parlamentarischen Gruppe Binnenschifffahrt (PGBi) für die CDU/CSU-Fraktion und MdB Mathias Stein (SPD), Koordinator der PGBi, sowie Dörte Maltzahn (Knauf Gips KG) und BDB-Präsident Martin Staats.
„Der Rhein ist die Lebensader für die von uns benötigten Erztransporte. Täglich werden 50.000 t Güter angeliefert, die auch nicht auf andere Verkehrsträger verlagert werden können. Fällt die Wasserstraße als Versorgungsweg aus, ist dies für uns existenzbedrohend“, erklärte Micken. Dörte Maltzahn bekräftigte diese Einschätzung: „Wir brauchen Planungssicherheit, nicht nur im Hinblick auf den Schiffstransport selbst, sondern auch bezüglich der Verladung“.
Die Industrievertreter forderten, dass künftig bei der Entscheidung über Haushaltsmittel nicht mehr nur von Legislaturperiode zu Legislaturperiode, sondern strategisch gedacht wird: „Die Gelder müssen an konkreten Konzepten entlang entwickelt werden. Dabei muss man trimodal denken, denn durch eine Kombination von Verkehrsträgern lässt sich mehr erreichen“, betonte Markus Micken.
Martin Staats äußerte die Befürchtung, dass die jüngst von Bundesverkehrsminister Volker Wissing eingerichtete „Beschleunigungskommission“ für den Ausbau des Mittelrheins keine wirklichen Ergebnisse liefern wird – und kritisierte eine falsche Schwerpunktsetzung: „Die Beschleunigungskommission wird wohl eher ein reines Informationsgremium bleiben. Wir hören, dass die Bundesgartenschau 2029 im Mittelrheintal zu einer weiteren Verzögerung der dringend benötigten Abladeoptimierung führt. Man hat das Gefühl, dass der Wille, die Infrastruktur zu modernisieren, bloß Lippenbekenntnisse sind. Dadurch wird der Wirtschaftsstandort Deutschland gefährdet.“
Quelle: BDB, Foto: Berlin-event-foto.de, in der Schweizerischen Botschaft in Berlin diskutierte die Binnenschifffahrtsbranche mit Vertretern aus Industrie und Politik über die notwendigen Maßnahmen, um auch in Krisenzeiten die Versorgung von Wirtschaft und Verbrauchern per Binnenschiff sicherzustellen. Susanne Landwehr (DVZ), MdB Mathias Stein (SPD), Martin Staats (MSG), MdB Henning Rehbaum (CDU), Dörte Maltzahn (Knauf Gips), Markus Micken (ThyssenKrupp Steel), MdB Jürgen Lenders (FDP)