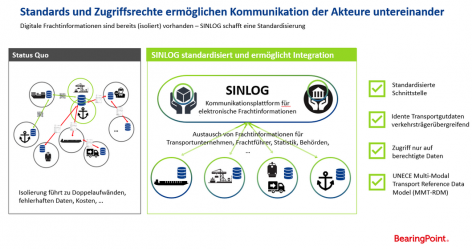BDB plädiert für 135-Meter-Schiffen

Das Bundesverkehrsministerium beabsichtigt, die Verlängerung der Schleusen am Neckar für die Nutzung von 135-Meter-Schiffen komplett aufzugeben. Dies hat Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) dem Landesverkehrsminister Baden-Württembergs, Winfried Hermann (Grüne), am 12. April 2022 in einem Schreiben mitgeteilt.
An die Stelle der Verlängerung der Neckarschleusen sollen nur noch Maßnahmen treten, die einen Ausfall des Neckar als Verkehrsweg verhindern. Die planerischen Zeiträume würden die für eine Realisierung der Schleusenverlängerung zuletzt gesetzten Zeitziele deutlich überschreiten, heißt es in dem Schreiben, das der BDB-Geschäftsstelle vorliegt. „Der Maßnahmenumfang am Neckar ist in der Vergangenheit deutlich unterschätzt worden. Der Instandsetzungsbedarf ist alters- und zustandsbedingt deutlich höher als gedacht“. Das Ziel sei nun, „auf dem Neckar maximale Verlässlichkeit des Schleusenbetriebs sicherzustellen.“
Der Bundesverband der Deutschen Binnenschifffahrt e.V. (BDB) kritisiert diese Entwicklung: Das Alter und der Zustand der Bauwerke am Neckar sind dem Bund als Verantwortlichem der Wasserstraßeninfrastruktur seit vielen Jahren bekannt. Seit 14 Jahren gibt es eine Verwaltungsvereinbarung zwischen dem Bund und dem Land Baden-Württemberg, die die Verlängerung der 27 Schleusen von Mannheim bis Plochingen zum Gegenstand hat. Die Verlängerung der Neckarschleusen wurde ausgiebig untersucht und analysiert, im Bundesverkehrswegeplan notiert und im Jahr 2016 als „vordringlicher Bedarf“ im Wasserstraßenausbaugesetz aufgenommen. Trotz anderslautender Zusagen wurde bis heute jedoch keine einzige Schleuse ausgebaut. Ob ein Organisationsversagen oder fehlende Finanzmittel ursächlich sind, muss das Bundesverkehrsministerium erklären.
Zum Ausbaubedarf erklärt BDB-Vorstandsmitglied Jens Langer (DP World): „Das Schifffahrtsgewerbe ist ebenso wie die verladende Wirtschaft und die Binnenhäfen dringend auf die Verlängerung der Schleusen angewiesen, denn wir wollen Schiffe mit einer Länge von 135 Metern zum Einsatz bringen. Diese Schiffe in Kombination mit einer 24/7-Schleusung bieten die Möglichkeit, unseren Kunden attraktive Angebote für einen besonders umweltschonenden Gütertransport anzubieten. Eine Rückverlagerung von Transporten auf die Straße oder die bereits jetzt überlastete Schiene ist der falsche Weg. Des Weiteren wird ein Ausbaustopp erheblichen Einfluss auf das Investitionsverhalten innerhalb der Europäischen Metropolregion Stuttgart und der Anbindung an den globalen Güterverkehr haben. Investitionen in klimafreundliche Antriebe ohne Sicherheit der Grundversorgung der Region werden nicht mehr attraktiv sein.“
Landesverkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) hat in einem Antwortschreiben an Bundesverkehrsminister Volker Wissing nicht nur ein klares Bekenntnis zu den zwischen Bund und Land geschlossenen Vereinbarungen, sondern auch umgehend sichtbare und koordinierte Maßnahmen zum Ausbau der Schleusen gefordert. „Es verfestigt sich der Eindruck, dass der Bund ein verkehrsinfrastrukturelles Jahrhundertprojekt trotz zunehmender Dringlichkeit verschleppt und damit faktisch den Bruch der Verwaltungsvereinbarung, der Beschlüsse des BVWP, des Bundeswasserstraßenausbaugesetzes und auch den aktuellen Vereinbarungen des Koalitionsvertrages betreibt“, heißt es in dem Schreiben vom 20. April 2022, das dem BDB vorliegt.
Quelle und Foto: BDB, auf dem Neckar werden rund 5 Mio. Tonnen Güter pro Jahr transportiert. Um noch mehr Güter umweltfreundlich auf das Wasser zu verlagern, sollen die 27 Schleusen von Mannheim bis Plochingen verlängert werden. Der Ausbau der Schleusen ist als verkehrspolitisches Ziel im Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung verankert.