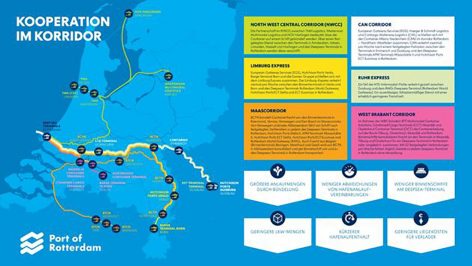Elbe Allianz e.V. begrüßt Elbeabkommen

Mit der Unterzeichnung des Elbeabkommens wird nach vier Jahren eine Forderung des deutschen Bundestages umgesetzt. Die Kritik von Seiten der Umweltverbände und anderer Stellen hält die Elbe Allianz für unbegründet.
Die Elbe soll schiffbarer werden. Das ist das erklärte Ziel des Abkommens zur Verbesserung der Schiffbarkeit der Elbe. Am 20. Juli 2021 unterzeichneten der tschechische Verkehrsminister, Karel Havlíček, und sein deutscher Amtskollege, Andreas Scheuer, das Abkommen. Fast auf den Tag genau wurde nach vier Jahren damit eine Forderung des Deutschen Bundestags umgesetzt. Neben der Umsetzung des Gesamtkonzepts Elbe (GKE) sieht das Abkommen auch die Erarbeitung von Vereinbarungen mit der Tschechischen Republik vor. Diese sollen dem Nachbarland Sicherheit über den Erhalt der Binnenelbe als internationale Wasserstraße geben.
Beide Länder haben ihre nationalen Planungsgrundlagen in das Abkommen integriert. Für Deutschland ist das GKE mit allen Bestandteilen die Basis für die Ausbauplanungen, für die tschechische Seite die Sicherung der vorhandenen Abladebedingungen mit einer nutzbaren Wassertiefe von 2,30 m von Ústí nad Labem und Týnec nad Labem und der weitere Ausbau bis Pardubice auf 2,30 m Wassertiefe.
Irritiert ist der Vertreter des Elbe Allianz e.V. im Beirat im Anschlussprozess des GKE, Stefan Kunze, über die aktuellen Reaktionen von Umweltorganisationen, aber auch Landesbehörden über das Abkommen. „Der Bezug auf das Gesamtkonzept Elbe sichert neben den verkehrlichen Zielen auch eine Vielzahl, wenn nicht sogar Mehrzahl ökologischer Maßnahmen, als auch Fragen zum Hochwasserschutz und weiterer Nutzungsbelange“ erläutert Stefan Kunze. „Vielleicht ist das Fehlen von direkten Umweltzielen im Abkommen die Ursache“, vermutet er und verweist auf den Charakter als Verkehrsvertrag. Gleichzeitig könnten Unklarheiten hinsichtlich der Begrifflichkeiten zwischen beiden Ländern die Ursache sein.
Kunze weist darauf hin, dass die tschechischen und deutschen Angaben zur Wassertiefe nicht direkt vergleichbar sind. Während in Tschechien im gestauten Bereich die 2,30 m eine tatsächlich vorhandene Wassertiefe aufzeigen, sind die 1,40 m Fahrrinne in Deutschland eine rein wasserbauliche Planungskennziffer. Direkte Rückschlüsse auf die tatsächliche Wassertiefe sind auf deutscher Seite daher nicht möglich und neben dem Ausbauzustand auch stark von dem aktuellen Wasserangebot abhängig. „Die Schifffahrt und ihre Kunden finden daher zum Teil deutlich bessere Abladebedingungen vor, aber leider – wie in den vergangenen drei Jahren – auch deutlich schlechtere Bedingungen.“ Klar sei aber auch der Zusammenhang zwischen Abladebedingungen und transportierten Gütermengen – kein Wasser, keine Ladung und umgekehrt.
„Wir sind uns sicher, dass nach Umsetzung des GKE den Verladern in Deutschland und der Tschechischen Republik ein zuverlässigerer Transportweg zur Verfügung stehen wird“, beschreibt Kunze die Erwartungen der Wirtschaft.
Der Verkehrsminister Karel Havlíček unterstrich die Ziele des Abkommens im Anschluss an die Unterzeichnung. „Die Elbe ist ein wichtiger europäischer Fluss, für den die Tschechische Republik und Deutschland Verantwortung tragen. Kurz gesagt, wir werden die Elbe auf Kurs bringen, so dass die Schifffahrt an 340 Tagen im Jahr möglich sein wird. Das Ziel ist es, bis 2030 die Schifffahrt auf der Elbe von Pardubice bis Hamburg zu haben.“ Damit wird die Elbe ein wichtiger Bestandteil des europäischen TEN-T-Netzes, einem Netzwerk der wichtigsten Verkehrsverbindungen von europäischer Bedeutung.
Quelle: Elbe Allianz e.V., Foto: HHM/ Kunze, das Abkommen sorgt auch für tschechische Koppelverbände, hier bei Dresden, für mehr Planungssicherheit.