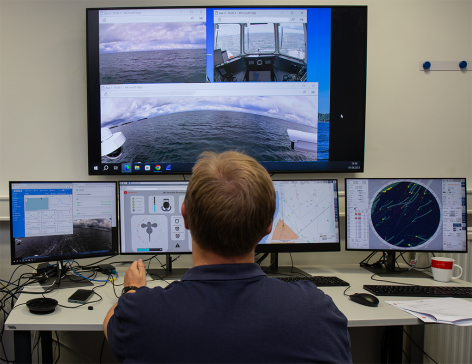Eine schlagkräftige Allianz mehrerer Häfen und Eisenbahnbetreiber will für eine spürbare Entlastung der Verkehrssituation im Ruhrgebiet und in Südwestfalen sorgen. DeltaPort, duisport, der Hafen Dortmund sowie die Kreisbahn Siegen-Wittgenstein werden unter dem Projektnamen „LOG4NRW“ zeitnah ein Bahn- und Binnenschiffsystem etablieren, mit dem ein erheblicher Anteil der Lkw-Verkehre in Nordrhein-Westfalen von der Straße auf Schienen und Wasserstraßen verlagert werden kann. Dies haben die Partner heute in Siegen bekanntgegeben. Die Schirmherrschaft für das Projekt übernimmt Oliver Krischer, Minister für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen.
Bis zu 27.000 Lkw-Fahrten können durch das neue Verkehrsangebot überflüssig werden. Die ersten Züge sollen schon im vierten Quartal 2023 rollen. Das geplante Konzept sieht folgende Verbindung vor: Voerde-Emmelsum (Container-Terminal Contargo) – Duisburg-Walsum logport VI (Multimodal Terminal Duisburg) – Hafen Dortmund (CTD Container- Terminal Dortmund) – Siegerland (Südwestfalen Containerterminal in Kreuztal) und zurück. Dies führt zu einer unmittelbaren Entlastung der Autobahnen 2, 4 und 45 sowie der ohnehin angespannten Verkehrssituation in Südwestfalen, insbesondere im Sauerland. Darüber hinaus ermöglicht das kombinierte Bahn- und Binnenschiffsystem erstmals Transporte zwischen den Terminals in Duisburg, Voerde-Emmelsum, Dortmund und Kreuztal.
Minister Krischer begrüßt diese Entwicklung: „Es freut mich sehr, dass es unseren Logistikunternehmen erstmalig gelungen ist, Schienengüterverkehre zwischen wichtigen Wirtschaftsregionen Nordrhein-Westfalens zu schaffen. Dies ist gerade für die Region rund um die Rahmedetal-Brücke besonders wichtig. Die Zukunftskoalition Nordrhein-Westfalens will die Verkehrsverlagerung von der Straße auf Schiene und Wasserstraße. Darum fördert Nordrhein-Westfalen seit vielen Jahren die Nicht-Bundeseigenen Eisenbahnen im Infrastrukturausbau.“
DeltaPort als Impulsgeber der LOG4NRW-Projektidee hat sich bereits frühzeitig dem Thema der Verkehrsverlagerung gewidmet und in Zusammenarbeit mit der Universität Duisburg-Essen Lösungsansätze erarbeitet. Die regionale Vernetzung über den Einsatz von Binnenschiff und Bahn zur Hebung von Verkehrsverlagerungspotenzialen stand hierbei im Fokus. Aus diesem Impuls heraus wurde gedanklich das Projekt „LOG4NRW“ geboren. LOG steht hierbei für „Logistik“ und „4“, auf Englisch „four“ oder auch „for“ ausgesprochen, bedeutet „Logistik für Nordrhein-Westfalen“. Ziel des Projektes „LOG4NRW“ ist es, Quell- und Zielverkehre des bevölkerungsreichsten deutschen Bundeslandes auf alternative Verkehrsträger (Schiff / Bahn) zu verlagern. Im Rahmen der Kooperation mit dem größten Binnenhafen der Welt streben die Projektpartner nunmehr die kurzfristige Realisierung der Konzeptidee an.
Der Hafen Dortmund als Logistikdrehscheibe für den Raum Dortmund, östliches Westfalen, Sauer- und Siegerland, verfügt über starke tägliche Bahnverbindungen in Richtung der deutschen Seehäfen. Zahlreiche Großverlader werden auf der letzten Meile von den beiden Dortmunder KV-Terminals (KV = Kombinierter Verkehr) beliefert. Die ARA-Häfen (Amsterdam, Rotterdam, Antwerpen) sind über die Häfen in Duisburg und Voerde-Emmelsum angebunden.
Das Südwestfalen Container-Terminal der Kreisbahn Siegen-Wittgenstein verfügt derzeit über keine Bahnanbindung an die Drehscheiben Dortmund und Duisburg/Voerde-Emmelsum. Container aus dieser Region werden also derzeit per Lkw zu den Hinterlandterminals Rhein/Ruhr oder direkt in die Seehäfen transportiert. Die Krombacher Brauerei als Großverlader liegt nur sechs Kilometer oder zehn Minuten Fahrzeit vom Terminal entfernt. Der bundesdeutsche Getränkefachgroßhandel nutzt das Südwestfalen Container-Terminal heute bereits zur Versorgung der Regionen Berlin, Bremen und Hamburg.
„Mit LOG4NRW bieten wir Deutschlands drittstärkster Wirtschaftsregion, Südwestfalen, auf einen Schlag ein Füllhorn an maritimen und kontinentalen Schienenverkehren zur Entlastung der Stau geplagten Ausweichrouten entlang der A45“, betont Landrat Andreas Müller, Aufsichtsratsvorsitzender der Kreisbahn. „Zugleich haben wir nun die Voraussetzung geschaffen, dass Unternehmen in der Region verstärkt über die Verlagerung von Transporten von der Straße auf die Schiene nachdenken können, weil es praktikabel und wirtschaftlich ist sowie auch ökologisch Sinn macht“, so Kreisbahn-Geschäftsführer Christian Betchen.
„Wir müssen die Anstrengungen vorantreiben und erhöhen, um unsere Bürgerinnen und Bürger und die Wirtschaft mit resilienten und nachhaltigen logistischen Lösungen zu versorgen. Als Landrat des Kreises Wesel freue ich mich besonders über den Startschuss des durch DeltaPort initiierten Logistikkonzeptes LOG4NRW, welches nunmehr gemeinsam mit dem Duisburger Hafen, dem Dortmunder Hafen und der Kreisbahn Siegen-Wittgenstein umgesetzt wird. Dieses wird erhebliche Lkw-Verkehre von unseren Straßen auf Bahn und Binnenschiff verlagern und somit einen bedeutenden Beitrag zur Mobilitätswende und zur CO²-Reduktion in NRW leisten können“, freut sich Landrat Ingo Brohl.
Die Disposition der Buchungen für alle Kooperationspartner übernimmt die duisport agency GmbH als zentrale Marketing- und Vertriebsgesellschaft der duisport-Gruppe. Die Traktion der Züge wird gemeinsam von der duisport-Tochtergesellschaft duisport rail GmbH und der Dortmunder Eisenbahn durchgeführt – von Emmelsum über logport VI in Duisburg, den Dortmunder Hafen und das CTD bis nach Kreuztal.
„Das Projekt LOG4NRW ist ein weiterer Beweis dafür, wie sinnvoll und effektiv Kooperationen innerhalb der Logistikbranche sein können. Hier entsteht eine vielfältige Win-win-Situation, von der nicht nur die beteiligten Partner, sondern auch Wirtschaft, Verbraucher und die Umwelt in Nordrhein-Westfalen profitieren“, sagt duisport-CEO Markus Bangen.
„Nachhaltigkeit und Resilienz bilden die Grundlage für die Abbildung CO²-armer und systemstabiler Logistikketten, die wir im Rahmen des LOG4NRW-Projektes als Partner gemeinsam initiieren wollen. Wir sind daher davon überzeugt, einerseits auf der Relation Emmelsum/Duisburg nach Dortmund und andererseits zwischen Dortmund und Kreuztal erhebliche ‚Last-Mile‘-Verkehre von der Straße auf die Schiene verlagern und somit einen erheblichen Beitrag für die Umwelt und die Wirtschaft leisten zu können“, sagt DeltaPort-Geschäftsführer Andreas Stolte.
„Die Kooperation der drei Binnenhäfen macht deutlich, dass Binnenhäfen zusammenarbeiten können und wollen und dabei einen großen Beitrag insbesondere im Bereich der Verkehrswende in NRW leisten. LOG4NRW ist ein gutes Beispiel für zukünftige Kooperationen von Binnenhäfen, um die vorhandenen Potenziale der Wasserstraße in Kombination mit der Schiene im Hinterland deutlich zu machen und diese zu heben“, sagt Dortmunder-Hafen-Vorständin Bettina Brennenstuhl.
Quelle: duisport, Foto: KSW, v.l.n.r.: Markus Bangen (CEO duisport), Andreas Müller (LR Kreis Siegen-Wittgenstein), Bettina Brennenstuhl (Vorständin Hafen Dortmund), Oliver Krischer (Minister MUNV NRW), Andreas Stolte (GF DeltaPort), Ingo Brohl (LR Kreis Wesel), Christian Betchen (GF Kreisbahn Siegen-Wittgenstein)